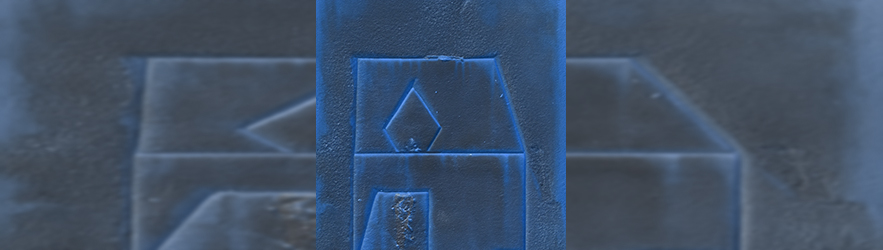ORTE PAUL CELANS
6
1952 erschien bei der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart ein schwarzes Bändchen, das auf den Auslagetischen der Buchhandlungen schon vom Äußeren her recht seltsam anmutete. Mohn und Gedächtnis stand in leicht schräg gestellten goldenen Lettern auf dem Einband, wobei vor allem die Initialen »M« und »G« ornamental geschwungen waren, und eingeschlagen war es in eine dünne Plastikfolie, die etwas anderes zu sein schien als ein Schutzumschlag.
Die Gedichte in diesem Band paßten nicht in eine Gegend, die vom »Kahlschlag« gezeichnet war, sie kamen aus einer anderen Landschaft, die Anfang der fünfziger Jahre in der Bundesrepublik niemand mehr kennen wollte. Nüchtern, sachlich, pragmatisch, so, wie es am besten ins Bild gepaßt hätte, war diese Lyrik nicht: sie war rauschhaft, sie kam vom Traum her. Vielleicht war Paul Celan mit dem Surrealismus in Verbindung zu bringen, den man auch noch nicht so gut kannte, ein bißchen Rilke schimmerte vielleicht noch durch; aber es war vor allem etwas Fremdes.
Der Alltag war in diesen Gedichten nicht aufzufinden, kein Widerhall von Wirklichkeit. Es gab zwar Bilder vom Krieg, von Rüstungen und Soldaten, aber sie hatten scheinbar nichts mit dem soeben beendeten Zweiten Weltkrieg zu tun: eher etwas mit Mittelalter, mit jener mittelhochdeutschen Verve, die die deutsche Romantik entdeckt hatte. Und immer wieder tauchten Worte auf, die Schlüsselworte zu sein schienen: Nacht, Herz, Stein, Herbst, Haar – Worte, die man durchaus gewohnt war, in einem eindeutigen Kontext zu lesen und in einen bekannten Sinnzusammenhang zu übersetzen. Doch in diesen Gedichten war jener Sinnzusammenhang leicht verschoben, die Grenzen schienen zu verschwimmen, und die Worte gingen neue Verbindungen ein, die nicht so leicht aufzulösen waren.
In diesen Verbindungen hatten auch die vielen Genitivmetaphern und Wie-Vergleiche ihren Platz – poetische Elemente, die gerade, unter anderem vom in dieser Zeit alles überstrahlenden alten Gottfried Benn, für nicht mehr zeitgemäß erklärt worden waren. Celan bewegte sich völlig außerhalb der beherrschenden Wortfelder. Ein seltsames, neuartiges Sinngeflecht hatte sich da aufgebaut, das schwer zu greifen war, aber in sich stimmig zu sein schien – zu suggestiv war der Rhythmus, die Farbe dieser Worte; das Ganze schien eine Welt in sich abzubilden, die unantastbar sein wollte, ihren eigenen Zauber bewahrte.
Mohn und Gedächtnis, das war eine Wortverbindung, die in dem Gedicht »Corona« auftauchte. Mit diesen beiden Worten ist ein Gegensatz ausgedrückt, und dieser Gegensatz ist auf irritierende Weise schon in der Sprache selbst enthalten: etwas Konkretes und etwas Abstraktes stoßen hier aufeinander, etwas Sinnliches und etwas Begriffliches. Der Mohn ist die Blüte, die am schnellsten verwelkt, es lohnt sich nicht einmal, sie in eine Vase zu stellen – und aus ihrer Kapsel wird Opium gewonnen. Der Mohn ist auf den Augenblick bezogen, vermittelt etwas Rauschhaftes. Gegenüber der Dauer des »Gedächtnisses« muß das, was durch den »Mohn« erfahren wird, der Vergessenheit anheimfallen, um wiederentdeckt und bewahrt werden zu können. Es ist eine geheime Verbindung zwischen den Gegensätzen zu ahnen, zwischen Augenblick und Dauer – eine Verbindung, die durch die sprachliche Form hergestellt wird, durch die Klangfarbe, durch die Rhythmik der Bilder. Das Gedicht »Corona« führt dies in all seinen Widersprüchlichkeiten vor.
CORONA
Aus der Hand frißt der Herbst mir sein Blatt: wir sind Freunde.
Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn:
die Zeit kehrt zurück in die Schale.
Im Spiegel ist Sonntag,
im Traum wird geschlafen,
der Mund redet wahr.
Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten:
wir sehen uns an,
wir sagen uns Dunkles,
wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis,
wir schlafen wie Wein in den Muscheln,
wie das Meer im Blutstrahl des Mondes.
Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße:
es ist Zeit, daß man weiß!
Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt,
daß der Unrast ein Herz schlägt.
Es ist Zeit, daß es Zeit wird.
Es ist Zeit.
Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen dem Handwerk des Dichters und der Jahreszeit des Herbstes, das Ich des Gedichts identifiziert sich mit dem Herbst. Das »Blatt« ist dabei das Zentrum der Assoziationsfäden: es ist dem Herbst wie dem Dichter zugehörig. Das Blatt, das der Dichter zur Verfügung hat, ist vom Herbst gezeichnet. Es ist nicht mehr das grüne, sprießende Blatt, sondern jenes, das sich im Übergang befindet, in einer charakteristischen Zwischenzeit zwischen Erblühtem und Verwelken, in einem Stadium, in dem es kurz vor dem Vergehen noch einmal all seine Kräfte zu konzentrieren scheint und von innen her aufglüht.
Im Unterschied zum Sommer – dem Leben, dem Augenblick, dem Raschvergehenden – ist der Herbst der Zeitpunkt, in dem dieses Raschvergehende als solches bewußt wird, es ist der Zeitpunkt, in dem das Leben zur Dichtung gerinnt.
Hier tritt der Dichter auf: er hat das Blatt in der Hand, der Herbst »frißt« es ihm »aus der Hand«: die umgangssprachliche Wendung »jemandem aus der Hand fressen« schillert zwischen dem Machtgestus auf der einen und der Ergebenheit auf der anderen Seite. Bei Dichter und Herbst handelt es sich um eine gegenseitige Abhängigkeit, um eine Symbiose. Für den Dichter zeigt sie sich darin, daß sich die Perspektive umkehrt – der Herbst holt sich sein Blatt zurück.
Der Herbst und die Dichtung stehen an der Schwelle zwischen dem augenblicksbetonten Leben und der Erinnerung. Im Herbst wird der Gegensatz von Sommer und Winter für eine kurze Zeit aufgehoben, er ist Vollendung und Vergängnis zugleich. Das »Wir«, das die nächsten beiden Zeilen bestimmt und das Ich und den Herbst zusammenfügt, steht in diesem Zeichen, sie bringen beide etwas zur Reife:
Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn.
Doch ist dies nur ein Moment in einem bestimmten Kreislauf. Die Zeit, obwohl sie in manchen Situationen verfügbar gemacht werden kann, entzieht sich letztlich immer wieder. Daß die Zeit für den Dichter fruchtbar gemacht werden kann, verhindert nicht, daß er der Zeit ausgeliefert bleibt. Die »Zeit«, auf die dieses Gedicht zuläuft, ist doppelgesichtig.
Man kann zwei Kategorien der Zeit unterscheiden: zum einen die der Unumkehrbarkeit und Linearität, die Zeit der »Geschichte«, zum anderen die der zyklischen Prozesse: Tag und Nacht oder die Jahreszeiten. Diese zweifache Struktur der Zeit, sagt der Physiker Friedrich Cramer, sei jedem System eigen: die Zeit der Linearität stehe für die Veränderung, die Zeit der Zyklen für die Selbsterhaltung. »Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn: / die Zeit kehrt zurück in die Schale« – hier berühren sich die lineare Zeit und die wiederkehrende Zeit. Wenn der Augenblick faßbar wird, erfährt das Ich sich selbst. Es ist ihm aber gleichzeitig der Prozeß des Vergehens bewußt. Der einzelne Augenblick ist unwiederholbar.
Diese Erfahrung ist die Voraussetzung dafür, einen Erinnerungsspeicher zu schaffen, das Gedächtnis. Es vermittelt zwischen Linearität und Wiederkehr – ein dialektischer Zusammenhang, der in steter Veränderung begriffen ist. Bewußt wahrgenommen wird das Vergehende, die Geschichte; der in sich geschlossene Kreis der Wiederkehr jedoch entzieht sich der Reflexion. Der Kreuzungspunkt zwischen der linearen und der wiederkehrenden Zeit ist mithin auch der, an dem sich Bewußtes und Unbewußtes kreuzen. Durch Anstöße des Augenblicks können Erfahrungen aktualisiert werden, die nicht unmittelbar zugänglich sind.
Nach den tastenden, unruhigen, langzeiligen drei Versen des Beginns sind die nächsten drei Zeilen, ist die nächste Versgruppe statuarisch, von einer traumwandlerischen Sicherheit. Sie wirkt wie eine Anrufung. Kein Ich oder Wir taucht hier auf, sondern beschwörende Aussagesätze. Ein Raum gerät ins Blickfeld, der dem unmittelbaren Zugriff des Ich entzogen ist, ein Raum abseits der tagesaktuellen Zerstreutheit: etwas, was aus einem dunklen, in sich kreisenden Kraftfeld kommt.
»Im Spiegel ist Sonntag«: In der Imagination des Spiegels suchen wir, uns zu vervollständigen. In Rilkes Malte Laurids Brigge, einem den jungen Celan prägendem Buch, gibt es eine Szene, in der das Ich des Textes vor dem Spiegel steht und spürt, daß der Spiegel ihn nicht annimmt. Der Spiegel zeigt, ob sich das Ich seiner selbst sicher ist, in seiner Gesamtheit – ein Spiegelbild, das Rilke in den »Engeln« der Duineser Elegien wieder aufnimmt.
In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch der »Spiegel«-Vers in »Corona«. Sonntag, das ist der Tag des Gedenkens, des Innehaltens. Der Sonntag vermittelt zwischen dem Augenblick und der Ewigkeit, und das Gedicht ist auf dem Weg dorthin. Die zweite Anrufung bezeugt dies: »im Traum wird geschlafen«, das weist auf ein Sich-Sammeln, auf den Schlaf als Neubeginn, auf den Weg, auf dem das Gedicht zu sich selbst kommt. Dieses Gedicht, nicht die Alltagssprache, in der wir uns vorantasten, könnte von sich auch behaupten:
der Mund redet wahr.
Dies wäre das Ziel.
Nachdem hier etwas Fernes aufgetaucht ist, führt die nächste Versgruppe wieder in das Bewußtsein des suchenden Ich im Gedicht zurück. Es ist etwas aufgetaucht, das Ich kreist nun nicht mehr um sich selbst, sondern beschreitet einen Weg. »Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten«: wenn Blicke zeugen könnten… Es gibt eine Sehnsucht, die Zonen des Gedächtnisses, der Abstrakta, des Bewußtseins mit denjenigen des augenblickhaften Rauschs verschmelzen zu lassen, das Unwiederholbare und die zyklische Wiederkehr zusammenzudenken.
»Erkennen«, der biblische Ausdruck für den Geschlechtsakt, und dieses »Aug« bewegen sich im selben Wortfeld. Ge-schlecht, Ge-liebte: durch die Anapher ist der Raum des Ge-dächtnisses vorweggenommen. Der Versuch der Dichtung ist es, in einem ekstatischen Augenblick das Vergängliche und das Ewige in eins zu setzen.
Das »Wir« wird in den folgenden Zeilen im Stakkato gesetzt. Diese anaphorischen Versanfänge, dieses proklamierte Wir wirken wie eine Steigerung. Die neue Verbindung, die das Ich eingeht, befindet sich auf einer anderen Stufe als die der Identifikation mit dem Herbst. Das Ich des Dichters verschmilzt mit dem der Geliebten zu etwas Rauschhaftem, es wird ersetzt durch den lyrischen Prozeß:
wir sehen uns an,
wir sagen uns Dunkles.
»Der Mund redet wahr«, der Vers aus der zweiten Versgruppe, ist die Vision dieses »wir sagen uns Dunkles«. Die Kommunikation findet statt, doch sie geschieht in einem Zwielicht, in einem Zwischenbereich zwischen Tag und Nacht, zwischen Nacht und Morgen, zwischen Sprechen und Schweigen. Die klaren Zonen des Bewußtseins sind nicht der Ort dieses »Dunklen« dieses Dunkle ist etwas Unverständliches, Vorantastendes, doch es gibt eine eindeutige Richtung der Bewegung. Der Abstand zwischen »der Mund redet wahr« und »wir sagen uns Dunkles« soll immer geringer werden, es soll dasselbe sein. Augenblick und Erinnerung, das unwiederholbar Sinnliche und das gedankliche Erfassen, Kunst und Leben sollen kein Widerspruch mehr sein.
Das »Dunkle«, das hier gesagt wird, entspricht auf diese Weise dem Werden des Gedichts: einer Form, die vom zeitlosen Zustand jener Bereiche, in die das Bewußtsein nicht hinreicht, gezeichnet ist und nach etwas Neuem sucht.
Während in der unmittelbaren Wahrnehmung alles der Zeitlichkeit unterworfen ist, einer ständigen Veränderung, sind die Erinnerungen statisch festgehalten. Der Vermittlungsprozeß, die Erinnerungen in ihrem in sich abgeschlossenen Zustand mit der unmittelbaren Niederschrift auf dem Papier in Verbindung zu bringen, findet im Dunklen statt, in einem Sprechen, das nach seiner eigenen Form sucht und den landläufigen Selbstverständlichkeiten entzogen ist.
In der Liebe wird die Zeit außer Kraft gesetzt. Es gibt nur noch die individuelle Zeit des Erlebens. Die Liebe ist die Synkope im Prozeß der Erinnerung, der Trauer, des Verlusts; »Mohn und Gedächtnis« sind die beiden Pole, zwischen denen sich die Erfahrungen bewegen.
Das Gedicht spricht von der Erfahrung der Liebenden, zwischen Augenblick und Ewigkeit, es spricht aber auch von der Erfahrung des Dichters. »Mohn und Gedächtnis«: das mißt die Spanne dessen aus, was der Dichter versucht und womit er sich konfrontiert sieht – »Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn«, und:
die Zeit kehrt zurück in die Schale.
»Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis« ist ein Vers, der die Definitionen zwischen Gedankenlyrik und Erlebnislyrik hinter sich gelassen hat. Das Sinnliche und das Abstrakte changieren beständig hin und her. Die beiden folgenden Bilder führen dies fort, und es ergeben sich Assoziationsfäden, die sich der einlinigen Übersetzung von vornherein entziehen:
wir schlafen wie Wein in den Muscheln,
wie das Meer im Blutstrahl des Mondes.
Form und Inhalt des Gedichts, Konkretes und Abstraktes durchdringen sich, ergeben ein neues, flirrendes Bezugsfeld, so wie sich »Mohn und Gedächtnis« gegenseitig anziehen und abstoßen und dadurch ein Drittes ergeben. Das »Gedächmis« bewahrt den Mohn davor, ein zweites Mal der Vergänglichkeit anheimzufallen. Die Dichtung geht durch das Rauschhafte hindurch; die Liebe nimmt denselben Verlauf wie der dichterische Prozeß und bleibt in der Form desselben erhalten.
»Schlafen«: das ist auf der einen Seite der Stillstand die Ruhe, der Raum, in dem es keine äußere Beeinflussung gibt; auf der anderen Seite ist das Erotische des »wir schlafen« virulent. Die Einheit im Widerspruch ist für Celans Gedicht grundlegend. Es ist der Versuch, den Augenblick in Dauer zu verwandeln, im Gedicht das festzuhalten, was in der unmittelbaren Erfahrung verlorengeht. Das Gedicht ist Erinnerung, es hält aber den ekstatischen Moment fest. In seiner Büchnerpreisrede umkreist Celan dieses grundlegende Paradoxon:
Die Dichtung: diese Unendlichsprechung von lauter Sterblichkeit und Umsonst!
»Wein« und »Meer« gehören dem Rauschhaften an, »Muschel« und »Mond« dem Statischen, Tiefen. Doch zwischen »Muschel« und »Meer« gibt es einen unlösbaren Zusammenhang: ein Zusammenhang, der sich fortsetzt, wenn man eine Muschel ans Ohr hält: man hört ein Rauschen, den eigenen Blutkreislauf.
In einem untergründigen Assoziationsgeflecht verweist hier Literatur auch auf Literatur, nimmt vorgängige Erfahrungen der Schrift auf: in Rilkes Malte Laurids Brigge findet sich eine Überlegung, die in diese Verse Celans eingegangen scheint:
Denn Verse sind nicht, wie die Leute meinen, Gefühle (die hat man früh genug) – es sind Erfahrungen. (…) Man muß Erinnerungen haben an viele Liebesnächte, von denen keine der andern glich. (…) Und es genügt auch nicht, daß man Erinnerungen hat. Man muß sie vergessen können wenn es viele sind, und man muß die große Geduld haben, zu warten, daß sie wiederkommen. Denn die Erinnerungen selbst sind es noch nicht. Erst wenn sie Blut werden in uns, Blick und Gebärde, namenlos und nicht mehr zu unterscheiden von uns selbst, erst dann kann es geschehen, daß in einer sehr seltenen Stunde das erste Wort eines Verses aufsteht in ihrer Mitte und aus ihnen ausgeht.
Die Liebe und das Gedicht eint, daß etwas nicht zu übersetzen ist. Außer in der Liebe, und außerhalb des Bezugssystems des Gedichts ist die Vermittlung zwischen Augenblick und Ewigkeit nicht möglich. Die Zeit der Liebe hat keine Uhren. Sie ist, um noch einmal den Physiker Friedrich Cramer zu zitieren, die exklusivste Form der irreversiblen Zeit: jede Wiederholung gefährdet die Liebe, schlägt ihr die Stunde. Und das Gedicht unternimmt den unmöglichen Versuch, dies in die Sprache nicht zurück-, sondern vorwärtszuholen.
In der nächsten Zeile wird das gesellschaftliche Moment benannt:
Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße.
Das Fenster vermittelt zwischen Innen und Außen, zwischen den Liebenden und ihrer Umgebung. Dies ist ein Ort der Utopie. Und diese Utopie zieht eine Kette von Imperativen nach sich, die formal die statuarischen Zeilen der zweiten Versgruppe wiederholen: die wiederholte Anrufung »Es ist Zeit«.
Auf dieses »Es ist Zeit« läuft das Gedicht zu. Das Bestreben, die Gegensätze zusammenzubringen, wird immer entschiedener:
es ist Zeit, daß man weiß!
Die Zeit, die vergeht, und das Wissen, das bleibt, laufen auseinander, das Gedicht zwingt sie zusammen, in einen Imperativ, der andere Imperative nach sich zieht. Diese anaphorische Form verbindet die dritte Versgruppe, in der das »Wir« sich zu finden versucht, mit der zweiten, in der der Raum des Gedächtnisses entfaltet wurde.
In der vierten Versgruppe gibt es, wie in der zweiten, kein Wir, es gibt nur den personentranszendierenden Imperativ. Aber die »Es ist Zeit«-Anrufungen sind von der Atemlosigkeit der Liebeserfahrung in der dritten Versgruppe durchdrungen. Das Gedicht läuft auf sich selbst zu.
In der Zeile »Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt« ist die Verbindung von Gegensätzlichem noch erkennbar: der Stein als Ausdruck von Schwere, Tiefe, in sich abgeschlossener Vergangenheit soll für den Augenblick präsent werden. Das Paradoxon »Es ist Zeit, daß es Zeit wird« braucht jedoch keinen Indikator mehr. Es ist aus der Konsequenz des Gedichts selbst hervorgegangen. Gegen Ende hin tritt eine Verlangsamung ein, ein allmähliches Stillstehen; die letzte Zeile ist der Stillstand, ist die Jetztzeit, eine Zeitlücke in der Jetztzeit: und in dieser Zeitlücke steht das Gedicht.
Diese letzte, alleinstehende Zeile »Es ist Zeit.«, in die das Paradoxon »Es ist Zeit, daß es Zeit wird« zusammenschmilzt, stellt das dar, was man gemeinhin als die »Aussage« des Gedichts bezeichnen müßte. Dieses »Es ist Zeit.« ist etwas zur Ruhe Gekommenes, eine Aufhebung der Gegensätze. Es spricht etwas Unmögliches aus. Das Unmögliche wird möglich im Gedicht.
Der Kreislauf, aus dem das Gedicht ausbrechen möchte, ist in ihm selbst gegenwärtig. Die ersten Zeilen werden von den letzten eingeholt, in einem neuen Zyklus der Wiederkehr allerdings, so, wie ein Baum immer neue Jahresringe ansetzt. »Die Zeit kehrt zurück in die Schale«, die Erfahrung des Anfangs, wiederholt sich zum Schluß, wird aber durch das Gedicht transzendiert.
Schon in der Form zeigt sich, daß es hier um die Vereinigung unterschiedlicher Prinzipien geht: die Langverse, in denen das Wir sich auf die Suche macht, und die Kurzverse mit knappen, Objektivität vermittelnden Aussagen wechseln sich ab und durchdringen sich gegenseitig. Die Unmittelbarkeit, der das Vergessen droht, wird im Gedächtnis des Gedichts bewahrt. Das gesamte Gedicht steht im Präsens, dem Tempus des Augenblicks und der Gegenwärtigkeit: durch diese Form entsteht Dauer – eine Dauer aber, die nur hier, im Gedicht auffindbar ist.
Auch das Versmaß entspricht der Bewegung dieses Gedichts. Das pochende »Es ist Zeit« nimmt den Anapäst der ersten Zeile wieder auf und umschließt die frei schwingenden Daktylen in der Mitte. Anapäst und Daktylus, der eine das Spiegelbild des anderen, umschlingen sich; die betonte und die beiden unbetonten Silben bilden einen Kranz. Im Bild dieses Kranzes sieht sich das Gedicht.
Während der Daktylus etwas Vorwärtstreibendes hat, etwas Sommerliches mithin, vermittelt der Anapäst die Reflexion, den Atem des Herbstes. Das Zusammenspiel von Daktylus und Anapäst, das Sich-Umschlingen der betonten und der beiden unbetonten Silben, der Kranz: es ist dies ein »rasender Stillstand« wie Paul Virilio die Zeiterfahrung »nach der Geschichte« genannt hat – das Gedicht als ein Rasen im Stillstand. Die Wiederkehr, aus der es keinen Ausbruch gibt, wird in diesem Ausbruch, in diesem Gedicht mit dem Titel benannt: Die Hauptbedeutung von »Corona« ist im Lateinischen »Kranz«. Eine Nebenbedeutung aber scheint für dieses Gedicht maßgeblich zu sein: »Corona« nennt man auch den Strahlenkranz um die Sonne, der nur bei einer totalen Sonnenfinsternis sichtbar wird.
In solch einer Finsternis strahlt auch dieses Gedicht.