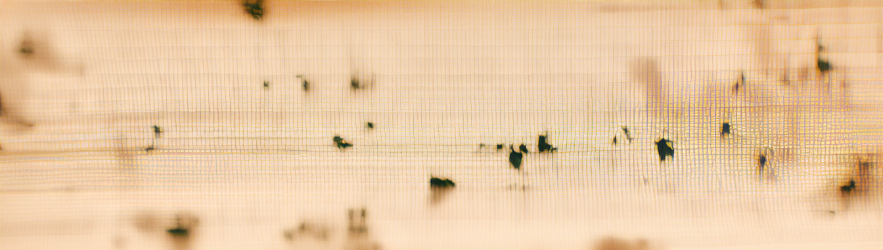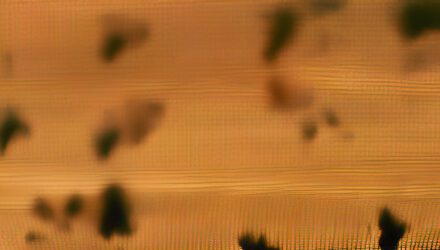ABSICHT, MÄNGELRÜGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Das 20. Jahrhundert war eine Blütezeit von Schriftstellern, die Staatsterror und Säuberungen überlebt haben, mit all den moralischen und politischen Ambivalenzen, die das mit sich brachte. Wie ist es dabei zugegangen? Waren sie zu standfest, um vor der Macht zu kapitulieren? Hatten sie ihr Überleben ihrer Hellsicht oder ihrer Intelligenz zu verdanken, ihren Beziehungen oder ihrem taktischen Geschick? Waren es Glücksfälle, die an ein Wunder grenzten, durch die sie dem Gefängnis, dem Lager und dem Tod entronnen sind, oder waren es Strategien, die von der Anbiederung bis zur Tarnung reichten?
Wer das so klar unterscheiden könnte! Nur allzuleicht fallen der Nachwelt Schlagworte wie Feigling, Trittbrettfahrer, Etappenhengst oder Opportunismus ein. Anderen wird Bewunderung für ihre Unbeirrbarkeit zuteil. Eine andere Taktik verdient es, erwähnt zu werden. Während die einen durch ihren internationalen Ruhm geschützt waren, wählten andere den Rückzug in die Unauffälligkeit und die Isolation. Vielen gelang die Emigration, doch das Exil wurde manchen zum Verhängnis. Joseph Roth sagte, wenige Tage vor seinem Tod, er sei dem Selbstmord nahe. Aber das wäre eine Sünde gewesen; deshalb zog er es vor, sich totzusaufen.
Egon Friedell war einer der ersten, die sich das Leben nahmen. In den Jahren darauf folgten ihm Kurt Tucholsky, Ernst Toller, Walter Hasenclever, Ernst Weiß, Walter Benjamin, Stefan Zweig und viele andere, deren Namen niemand mehr nennt. Manche ereilten Jahrzehnte später die Spätfolgen der Traumata, von denen sie gezeichnet waren. Klaus Mann, Jean Améry, Arthur Koestler, Primo Levi, Sándor Márai, der Perser Sadeq Hedayat und Paul Celan, das sind einige Namen derer, die nicht weiterleben wollten.
Viel länger fiele ein Register derer aus, die alles überstanden haben. Ihre Haltungen lassen sich auf keinen gemeinsamen Nenner bringen. Was hat der brave Soldat Schwejk mit einem skrupellosen Wendehals gemein? Wie unterscheidet sich der einfache Deserteur von jenem Intellektuellen, der in irgendeiner Schreibstube überwintert hat? Und was zeichnet die Schriftsteller aus, im Vergleich zu anderen Überlebenden? Kann es sein, daß der tiefe Glauben an ihre ›Berufung‹ und an ihr Talent dazu beigetragen hat, daß sie nicht zugrunde gegangen sind? »Aber das ist es ja gerade«, konstatiert Gombrowicz in seinem Tagebuch, »daß die Schriftsteller um keinen Preis aufhören wollen, Schriftsteller zu sein; sie waren zu den heldenhaftesten Opfern bereit, um nur immer weiter zu schreiben.« Oder hatten sie ganz andere, alltägliche, banale Motive? Zu denken geben am wenigsten die eindeutigen Fälle. Wahrscheinlich haben die meisten Autoren nie einen Schuß abgefeuert. Keiner von ihnen ist an der Front gefallen oder in einem Konzentrationslager ums Leben gebracht worden.
Das ist doch alles lange her, werden Jüngere sagen. Wirklich? Sind Anpassung, glückliche Zufälle, Kompromisse und mehrdeutige Entscheidungen von vorgestern? Kann man nichts von ihnen lernen? »Es kommen härtere Tage«, das kündigte Ingeborg Bachmann 1958 mit ihrem Gedicht »Die gestundete Zeit« an. Für den Fall, daß sie recht behält, könnte ein Training in der Kunst des Überlebens von Nutzen sein.
Frage: Warum keine Komponisten, Schauspieler, bildenden Künstler? Warum nur Schriftsteller?
Antwort: Weil ich mich mit diesem Milieu einigermaßen auskenne.
Frage: Warum gibt es unter Ihren Überlebenden so viele Juden?
Antwort: Weil sie ein Leben führten, das gefährlicher als das der anderen war, und weil sie einem Volk angehören, das sein Überleben in der Zerstreuung dem Buch verdankt. Die Selbstverstümmelung, die sich die deutsche Intelligenz durch ihre Judenfeindschaft zufügte, hat Folgen, die bis heute spürbar sind. Auch daraus erklärt sich die hohe Zahl der jüdischen Schriftsteller, von denen hier die Rede sein wird.
Und warum kein Wort über Figuren wie Hans Schwerte, Hans Robert Jauß oder Paul de Man?
Antwort: Solche Leute wußten zwar zu überleben, aber sie waren weit davon entfernt, Künstler zu sein. Deshalb kommen sie hier nicht vor.
Frage: Die eine Hälfte der Menschheit überwiegt bei Ihnen. Wo bleiben die Frauen? Sie sind in Ihrem Register nur eine Minderheit.
Antwort: Diese Differenz kann ich nicht ausgleichen. Bitte wenden Sie sich an das Patriarchat.
Frage: Und warum sind nicht alle Erdteile, alle Religionen und Hautfarben proportional vertreten? Antwort: Weil ich mich an solchen Abzählungsroutinen nicht beteiligen möchte. Die Literatur ist keine Olympiade, und einen Medaillenspiegel gibt es nicht.
Im übrigen verlangt mein Vorhaben die Ich-Form. »Ich« ist ja lediglich die erste Person Singular, die sich ungern den Mund verbieten läßt. Wer kein Historiker ist, kann und muß kein Kompendium liefern und keine unanfechtbaren Beweise führen. Er darf sich an einen subjektiven Erzählton und an eine subjektive Auswahl seiner Beispiele halten.
Moralische Urteile stehen einem Nachgeborenen, der die Situationen und Prüfungen nicht bestehen mußte, denen sie ausgesetzt waren, ohnehin nicht zu. Er kann versuchen, fair zu sein. Aber Neutralität kann er nicht in Anspruch nehmen.
Je größer das historische Übel, desto verlockender scheint das kleinere; und je gefährlicher die Umstände, desto mehr wird, wer sie verteidigt, die mildernden Umstände ins Feld führen. Vorliebe und Ekel, Bewunderung und Abneigung – daß solche Gefühle in die Darstellung einfließen, ist unvermeidlich.
Prominenz und Erfolg sind nur als Indizien von Belang. Die Nachwelt kümmert sich nicht um Ehrungen; sie macht, was sie will. Nicht nur die Autoren, auch ihre Werke werden hoch gehandelt oder für immer vergessen, und vielleicht irgendwann wiederentdeckt. Der Nobelpreis für Literatur wird zwar erwähnt, ist aber keine Garantie, sondern bloß eine Anekdote.
Das Wort Vignette stammt aus dem Französischen. Vigne ist die Weinrebe. Daraus leitet sich die Verkleinerung ab. Sie bedeutet zunächst die Kennzeichnung der Rebsorte, später auch das Etikett auf der Weinflasche. Im Lauf der Zeit wurde das Wort auf die Randverzierungen in der Druckerei übertragen. Als Vignette wird auch eine Variante der Porträtmalerei bezeichnet, die besonders im 19. Jahrhundert beliebt war. Es war Mode, geliebte Personen auf ovalen Miniaturgemälden abzubilden, die oft um den Hals getragen wurden und als Souvenir oder Talisman dienten. Bei solchen Vignetten wird das Bild zu den Rändern hin unschärfer und verschwindet allmählich im Hintergrund. Es gibt auch photographische Vignetten. Das waren Masken vor dem Objektiv der Kamera, um bestimmte Stellen der Aufnahme zu verkleinern, verschwommen erscheinen zu lassen oder ganz zu entfernen. Beim Belichten des Negativs im Labor sind noch weitere Manipulationen möglich. Die Vignetten wurden gern auf Porträts und Postkarten gedruckt und ließen sich zu Gruppenbildern vereinigen. Ähnliche Bilder finden sich in Kolumbarien, besonders in Italien, wo der heidnische Totenkult auf den Friedhöfen weiterlebt.