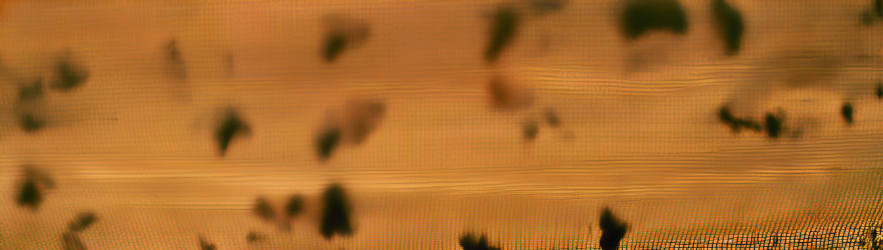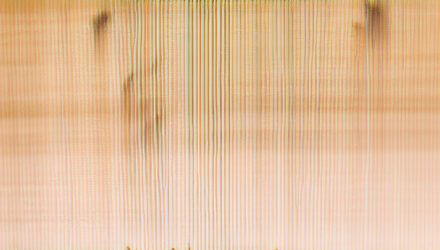Überlebenskünstler Hans Sahl
Wer war denn das noch mal? Wir können uns unmöglich alle Namen derer merken, die aus Deutschland vertrieben worden sind. Zwar gibt es eine auf acht Bände angelegte, aber nie zu Ende geführte Ausgabe der Werke von Hans Sahl, der als Hans Salomon geboren war. Sie ist sogar lieferbar, liegt aber in keinem Schaufester aus. Dabei geben schon die Titel zu denken: Der Mann, der sich selbst besuchte oder Memoiren eines Moralisten. Das Exil im Exil.
Hans Sahls Familie war jüdisch, großbürgerlich und assimiliert, mit einem durchaus deutschnationalen Akzent. Mit seinem Vater, dem Bankier Paul David Salomon, wuchs er in Berlin auf. Er studierte Kunstgeschichte, Archäologie, Literaturgeschichte und Philosophie. Nach 1922 machte er das Schreiben zum Beruf und arbeitete als politischer Journalist, Theater-, Film- und Literaturkritiker für die Presse, vor allem für Das Tage-Buch und den Berliner Börsen-Courier.
Benedikt Erenz hat geschildert, wie Sahl in den zwanziger Jahren »die Kriegselefanten der Literatur und der Kunst ebenso wie das schreibende Fußvolk« kennenlernte. Das Namenregister seiner Memoiren liest sich wie ein Who’s who des republikanischen Berlins. Man traf sich im Romanischen Café, nicht unbedingt am selben Tisch, sondern je nachdem, wer zu welcher Clique gehörte. Sahl erinnert sich genau an dieses Millieu und skizziert Porträts der Protagonisten, zu denen Bertolt Brecht, Erwin Piscator, Carl von Ossietzky, Herbert Ihering und Alfred Kerr gehörten. Mit Lotte Lenya, Kurt Weill, Alfred Polgar und Georg Grosz war er befreundet. Anna Seghers hat er gefördert, bevor sie namhaft war, und selbst ein unbekannter junger Mann namens Wolfgang Koeppen wird erwähnt, der am Rande irgendeiner Redaktionssitzung auftauchte.
Sahl hatte die Chance, in Berlin oder in Paris internationale Größen wie Asta Nielsen, Carola Neher, Greta Garbo, Sergej Eisenstein, Valeska Gert und Joseph Roth zu interviewen. Alldem machte das Jahr 1933 ein brutales Ende. Wie er die Tage nach dem Reichstagsbrand erlebte, schildert Sahl sehr detailliert:
Ich schlief nicht mehr zu Hause, ich ging ins Kino, vier- oder fünfmal am Tag, ich wohnte im Kino, ich wohnte in Warenhäusern und Cafés, fuhr zwischendurch in meine Wohnung, stellte fest, daß noch niemand dagewesen war, verbrannte Papiere oder warf sie ins Klosett, holte sie wieder heraus, weil sie das Klosett verstopft hatten, lief über den Dachgarten auf das Nachbarhaus, weil ich glaubte, es hätte geklingelt.
Jemand hatte mir gesagt, ich wäre auf der schwarzen Liste… Wohl dem, der einen Onkel in Amsterdam oder einen Neffen in Shanghai, eine Kusine in Valparaiso hatte. Ich hatte keine Verwandten im Ausland.
Er emigrierte über Prag und Zürich nach Paris, wo er Texte für Erika Manns Kabarett-Ensemble Die Pfeffermühle schrieb. Dort geriet er bald zwischen die ideologischen Mühlsteine des Exils. Der Widerstand gegen die NS-Diktatur war gespalten. Sahls undogmatische Haltung isolierte ihn von den Anhängern Stalins. Ihm fiel auf, daß das Regime des »Dritten Reiches« dem der Sowjetunion ziemlich ähnlich war. Das bedeutete, daß er auch im Exil ein Außenseiter war und blieb. Zu dieser Einsicht kam er ganz ohne Totalitarismus-Theorie.
1939 wurde er als »unerwünschter Ausländer« in verschiedenen französischen Lagern interniert, konnte aber nach Marseille fliehen. Varian Fry, ein amerikanischer Journalist, half im Auftrag des Emergency Rescue Committee bei der Rettung politisch Verfolgter und verschaffte ihnen ein Visum. Sahl unterstützte ihn dabei. Als die Vichy-Regierung begann, Emigranten an die Deutschen auszuliefern, floh er schließlich selbst über die Pyrenäen und über Portugal in die USA.
In New York sind mehrere seiner Bücher entstanden. Er stand einer Gruppe um Ruth Fischer nahe, die seine Einschätzungen teilte. Nach dem Krieg hat er als Kulturkorrespondent für die Neue Zürcher Zeitung, Die Welt und die Süddeutsche Zeitung gearbeitet. Er übersetzte Maxwell Anderson, Arthur Miller, Thornton Wilder und Tennessee Williams. Als 70jähriger sprach er vom Los der Überlebenden seiner Generation in einem Gedicht:
Wir sind die Letzten.
Fragt uns aus.
Wir sind zuständig.
Wir tragen den Zettelkasten
mit den Steckbriefen unserer Freunde
wie einen Bauchladen vor uns her.
1953 versuchte er einen Neuanfang in Deutschland, fühlte sich aber im Klima der Adenauerjahre nicht willkommen und ging wieder nach Amerika. Behindert durch eine tückische Augenkrankheit, kehrte er im Alter von 87 Jahren endgültig in das Land seiner Geburt zurück und ließ sich in Tübingen nieder, wo er gestorben ist.