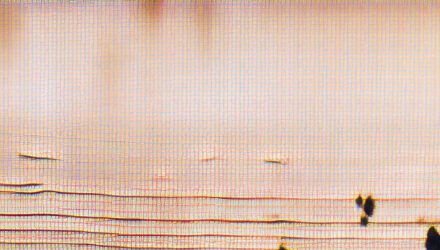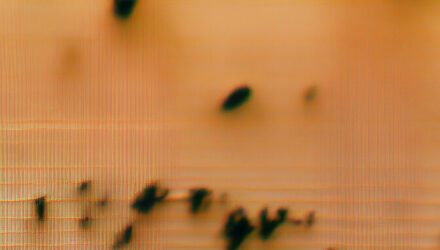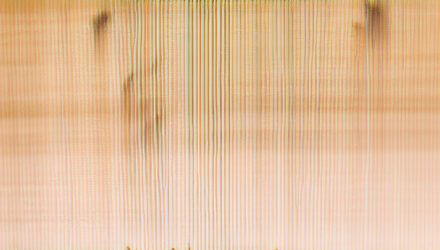Überlebenskünstlerin Nelly Sachs
Ja, ich habe sie gekannt. Diese erste Begegnung mit Nelly Sachs verdanke ich Alfred Andersch. Er war damals einer der wenigen, die Anteil nahmen am Los der aus Deutschland Vertriebenen und Geflohenen. Er besuchte sie in Stockholm und veröffentlichte Gedichte von ihr in seiner Zeitschrift Texte und Zeichen.
Ich konnte Schwedisch lesen und mich auf norwegisch ohne Mühe verständigen. Stockholm war in jenen Jahren nicht weit entfernt für mich. So nahm ich mir ein Herz und suchte sie im Januar 1958 zum ersten Mal in ihrer winzigen Wohnung am Bergsunds Strand auf. Die meisten Bewohner des Hauses, das der jüdischen Gemeinde gehörte, waren Entkommene. Reiche Mieter gab es dort nicht, aber der Ausblick auf den Mälaren war weit und der Himmel groß.
Auch Nelly Sachs hatte kein Geld, aber das war ihre geringste Sorge. Wer in ihre kleine, karge Wohnung kam, betrat eine andere Welt. Sie arbeitete eigentlich immer, und keine Silbe war ihr zu gering, um nicht bei ihr zu verweilen. Von dieser Frau, die so leicht wie ein Vogel schien, ging eine Intensität aus, die mich zunächst einschüchterte. Schon damals wußte ich einiges über ihr Leben und hatte eine Ahnung davon, was auf ihr lastete. Doch sie nahm mir meine Befangenheit gleich bei der ersten Begegnung. Ich weiß bis heute nicht, wie ich ihr Zutrauen gewonnen habe.
Ich vermied es, sie mit den üblichen Fragen zu quälen. Keine Theorien, keine Interpretationen, keine Versuche, ihr Werk, wie es immer heißt, irgendwo »einzuordnen«. Auch die Verehrung kann lästig sein, wenn sie den Verehrten die Türen einrennt.
So haben wir, während Nelly Sachs in der kleinen Küche ein Abendbrot herrichtete – sie war übrigens eine sehr gute Köchin –, zuerst über ganz gewöhnliche Dinge gesprochen, über die Familie, über Ärzte und Malaisen, über Landschaften oder den einen oder anderen Dichter. Es schien ihr zu gefallen, daß ich jedes Pathos vermied, nicht erwähnte, daß sie eine Seherin war, vielleicht die letzte in einer langen, ehrwürdigen Tradition. Manche ihrer Bewunderer mißverstehen die Mystiker. Sie verehren sie als Säulenheilige und halten sie für weltfremd, ganz so, als hätte Hildegard von Bingen nie ein Heilmittel gegen die Impotenz empfohlen, Jakob Böhme nie eine Ahle in die Hand genommen und Swedenborg nicht durch seine Erfindungen für den Bergbau geglänzt. Auch den Chassidim ist das Lachen nie vergangen. Gewiß ist es ein ganz besonderer, federleichter Humor, mit dem sie gesegnet sind, ein Humor, den nicht jeder verstehen kann.
Nelly Sachs war im schwedischen Exil einsam, aber keineswegs isoliert. Margaretha Holmqvist stand ihr zusammen mit Bengt, ihrem Mann, einem angesehenen Kritiker, jahrzehntelang bei. Mit fast allen, die damals in der schwedischen Dichtung eine Rolle spielten, war Nelly Sachs bekannt: mit Edfeldt, Lindegren, Vennberg, Lagerkvist, Martinson und Ekelöf. Viele ihrer Gedichte, die in Deutschland noch ganz unbekannt waren, hat sie übersetzt. Auch Olof Lagercrantz und Walter Berendson gehörten zu ihren Getreuen. Nelly Sachs war keine Einsiedlerin. Dafür spricht auch ihr umfangreicher und reichhaltiger Briefwechsel.
Jedesmal, wenn ein Kuvert ihre blaue Schrift trug, die mit den Jahren allmählich immer zittriger wurde, konnte der Empfänger gewiß sein, daß dem Brief ein neues Gedicht, eine Variante oder ein Übersetzungsentwurf beilag.
Es waren aber nicht nur Menschen aus der Sphäre der Literatur, mit denen sie umging. Am Bergsunds Strand wohnte Tür an Tür mit ihr eine Überlebende aus dem Todeslager Auschwitz. Sie hieß Rosi Wosk und stammte aus Ungarn. Immer war sie für Nelly da, nicht nur, wenn ihr traurig zumute war, wenn es ihr schlechtging oder wenn ein Medikament fehlte. Oft war auch bloß die Milch oder das Salz ausgegangen, eine Glühbirne mußte ausgewechselt, ein Paar Schuhe für Nellys winzige Füße gekauft werden.
Eine eigentümliche Stärke ging von Rosi aus, einer schwer traumatisierten Frau, die nie ihre Bodenhaftung verlor. Es war bewegend, zu sehen, wie sie, die Großgewachsene und bei weitem Jüngere, für Nelly die Mutterrolle übernahm und sie behütete. Sie besaß übrigens ein Fernsehgerät, und manchmal klopfte die
Dichterin bei ihr an, um mit ihr zusammen heimlich ein Fußballspiel anzusehen.
Aber wie der Mond hatte auch Nelly Sachs eine andere, unnahbare Seite. Vor ihrem Urteil hielten Posen, Eitelkeiten und Schwärmereien nicht stand. Ein Blick aus dem Augenwinkel reichte aus.
Nelly, eigentlich Leonie Sachs, war das einzige Kind einer Berliner Fabrikantenfamilie. Aufgewachsen ist sie im Milieu des jüdischen Großbürgertums. Als Kind war sie kränklich und mußte von Privatlehrern unterrichtet werden. Sie begeisterte sich für die deutsche Lyrik und fing an, selbst Gedichte zu schreiben.
Nach jahrelanger Krebserkrankung starb ihr Vater 1930. Das war ein Verlust, den sie nie verwunden hat.
Sie blieb unverheiratet. Ihr Vater hatte ihr die Liebesbeziehung zu einem geschiedenen Mann übelgenommen und ihr den Umgang mit ihrem Freund verboten. Dieser »Bräutigam« schloß sich später dem Widerstand an. Er wurde wegen seiner Liaison mit einer Jüdin verhaftet und in einem Konzentrationslager ermordet. Seinen Namen hat Nelly nie preisgegeben.
Wiederholt wurde sie von der Gestapo vernommen. Die meisten Mitglieder ihrer Familie hatten, solange dies noch möglich war, Berlin verlassen. Erst spät entschlossen sie sich, zu fliehen. Ihre Freundin Gudrun Harlan reiste im Sommer 1939 nach Schweden, um ein schwedisches Visum für Nelly und ihre Mutter zu erlangen. Ein Bruder des schwedischen Königs unterstützte sie dabei. Im Mai 1940 konnten die beiden Deutschland im letzten Moment mit einem Flugzeug nach Stockholm verlassen.
In Schweden sorgte Nelly Sachs für ihre kranke Mutter, die sich in der fremden Umgebung nicht zurechtfand. Um Geld zu verdienen, arbeitete sie als Wäscherin. Sie lernte Schwedisch und begann mit ihren Übersetzungen. Auch mit Paul Celan wechselte sie Briefe und besuchte ihn in Paris. Er zählte für sie zu den Eingeweihten.
Ihr erster Gedichtband nach dem Krieg, In den Wohnungen des Todes, ist auf Betreiben Johannes R. Bechers 1947 in Ost-Berlin erschienen, der zweite, Sternverdunkelung, in Amsterdam bei Querido/Bermann Fischer. Eine Lizenzausgabe brachte Suhrkamp heraus. Ansonsten wurden ihre Gedichte weder in der Schweiz noch in Westdeutschland gedruckt. Erst von 1959 an kam es zu neueren Publikationen. Ihre szenischen Dichtungen wurden aufgeführt und ihre Lyrik vertont. Eine wunderbare Wanderausstellung, von Aris Fioretos verantwortet, gab es 2010 in Berlin und Stockholm, dann auch in Zürich, Frankfurt am Main und Dortmund. Seitdem liegt eine kommentierte vierbändige Werkausgabe vor.
In Wahrheit hat die Zeit der Verfolgung für Nelly Sachs nie ein Ende genommen. Sie fühlte sich auch in Schweden bedroht. Manchmal konnte ich sie für eine Weile beruhigen, indem ich ihr versicherte, daß alle denkbaren Gegenmaßnahmen insgeheim längst getroffen waren. Das half für einen Abend oder ein paar Tage, aber auf die Dauer konnte niemand ihren Ängsten abhelfen.
1960 hat sie zum ersten Mal wieder deutschen Boden betreten, als ihr in Meersburg der Droste-Preis verliehen wurde. Nach ihrer Heimkehr brach sie zusammen. Die psychiatrische Klinik diagnostizierte paranoide Schübe. Die Ärzte taten ihr Bestes, konnten sie aber nicht heilen.
1966 verlieh das Nobelpreiskomitee ihr, gemeinsam mit Samuel Joseph Agnon, den Literaturpreis. Das bedeutete für Nelly Anerkennung, aber zugleich war es eine Last. Ihr Preisgeld verschenkte sie an Bedürftige; die Hälfte ging an ihre Retterin Gudrun Harlan. In ihrem Testament verfügte sie, daß ich mich um ihre Autorenrechte kümmern sollte. An ihre Anweisung, ihre Jugendgedichte nicht wieder auszugraben, habe ich mich gehalten, obwohl übereifrige Philologen immer wieder versucht haben, dagegen zu verstoßen.
Nelly Sachs ist im Mai 1970 an den Folgen einer Krebsoperation gestorben. Sie wurde auf dem jüdischen Friedhof von Solna beigesetzt.
Ihre Seelenstärke und die schiere Energie, mit der sie allen Schicksalsschlägen zum Trotz an ihrer Sendung festgehalten hat, sind unbegreiflich.