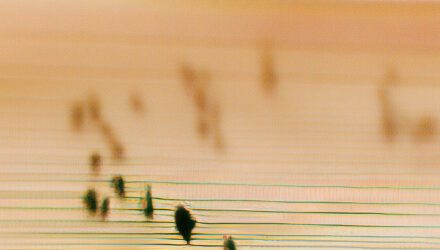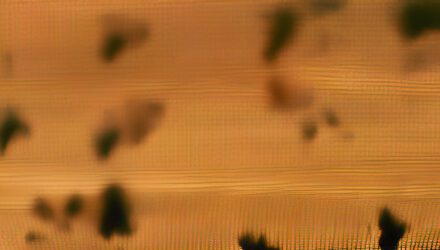Überlebenskünstlerin Nadeschda Mandelstam
Muß jemand, der uns etwas zu sagen hat, unbedingt ein Hauptwerk geschrieben haben? Reicht es nicht, das zwanzigste zum »Jahrhundert der Wölfe« zu erklären? Nadeschda Mandelstam hat das getan und begründet. Diese Autorin ist nicht nur die Witwe Ossip Mandelstams, dessen Werk sie gerettet hat, also gewissermaßen seine Stellvertreterin, sondern sie hat auch eine Autobiographie zu Protokoll gegeben. Das ist ein Buch, aus dem man über die sowjetische Geschichte ganz andere Dinge erfährt als aus der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung. Mit der Chronologie hatte diese Frau nichts im Sinn. Sie verwirrt den Leser, weil sie private, um nicht zu sagen intime Erfahrungen mit derselben Genauigkeit schildert wie die großen und blutigen Ereignisse im Kreml, die Verfolgungen, die Straflager und den Apparat der Geheimpolizei.
Wie mit der Handkamera richtet sie ihren Blick auf die Suche nach einer Matratze oder nach einem Stück Papier, auf einen Eimer, ein Bett, einen Petroleumkocher; dann fällt ihr ein Karamelbonbon ein, den ihr plötzlich während einer Hausdurchsuchung ein Tschekist angeboten hat.
»Zeugen dieser Epoche sind Manuskripte, die sie heil überstanden haben. Wir müssen das als Wunder anerkennen«, sagt sie. Mehr als jede andere hat sie zu diesem Wunder beigetragen, schon weil sie die Gedichte ihres Mannes auswendig lernte, um sie vor den »Organen« in Sicherheit zu bringen.
Bei der Auswahl seiner eigenen Todesart nützte Ossip Mandelstam »eine bemerkenswerte Eigenschaft unserer Führer: ihre grenzenlose Hochachtung der Dichtung gegenüber. ›Worüber beklagst du dich‹, sagte er, ›nur bei uns achtet man die Dichtung – für sie werden Menschen umgebracht. Das gibt es sonst nirgends.‹«
Geboren in Saratow in einer jüdischen Familie aus dem Bürgertum, hat Nadeschda 1919 Ossip kennengelernt und geheiratet. Eine ménage à trois war in der frühen Sowjetepoche nichts Außergewöhnliches. So ein Arrangement galt in manchen Kreisen als schick und progressiv. Eine Dreierbeziehung mit Anna Achmatowa schien anfangs auch nach Nadeschdas Geschmack zu sein. Sie nannte ihren Mann scherzhaft einen »Mormonen«. Über diese Verwicklungen hat sie sich später im Rückblick geäußert, in ihren Erinnerungen an Anna Achmatowa.
Doch konnte es auch geschehen, daß die erotische Situation außer Kontrolle geriet.
Ein Idyll war diese Ehe nie. Mandelstam war von Anfang an ein eifersüchtiger Patriarch, der ihr keine eigene Arbeit erlaubte und verlangte, daß sie völlig in seinem Leben aufging. Sie hingegen wollte unabhängig sein und sich niemandem unterordnen. Besonders sanftmütig, geduldig oder treu war sie nicht, und streiten konnte sie so gut wie ihr Mann. Sie fragte ihn:
Wozu brauchst du mich? Warum hältst du mich zurück? Wieso soll ich so leben wie in einem Käfig? Laß mich gehen!
1925 stellten die Ärzte bei ihr ein Anfangsstadium der Tuberkulose fest, und Ossip erlitt einen Herzanfall. Seine Briefe handeln vom zermürbenden Kampf um Geld, sind aber auch Liebeserklärungen. Weil Russen bekanntlich mehr Namen haben als andere Menschen, nannte er sie Nadja, Nadka, Nadinka, Nadjuschka, Naditschka und so weiter.
Bald waren sie beide gesundheitlich angeschlagen. Weil er ein Gedicht über Stalin geschrieben hatte, in dem er ihn als Mörder und Bauernschlächter bezeichnet, wurde Ossip 1934 verhaftet und nach Woronesch verbannt, vier Jahre später von neuem festgenommen und zu fünf Jahren Lager »wegen konterrevolutionärer Aktivitäten« verurteilt. In einem Straf- und Arbeitslager im Fernen Osten der Sowjetunion auf Hungerrationen gesetzt, herzkrank und von Halluzinationen geplagt, starb er in einer Krankenbaracke und liegt an einem unbekannten Ort begraben.
Nadeschda brachte die Kriegsjahre mit ihrer Freundin Anna Achmatowa in Taschkent zu. Wir sind »bloß Späne, uns reißt der ungestüme, ja rasende Strom der Geschichte mit sich fort«, das ist ihr Resümee.
Willkür hat unser ganzes Leben geprägt… Ich habe fast dreißig Jahre mit zusammengebissenen Zähnen gelebt.
Ende der fünfziger Jahre begann sie, ihre Memoiren zu schreiben, die im Ausland viel Aufsehen erregten. Sie erschienen Anfang der siebziger Jahre, auf deutsch unter dem Titel Das Jahrhundert der Wölfe und auf englisch, mit einem Wortspiel, als Hope against Hope, weil Nadeschda im Russischen »Hoffnung« bedeutet. In Rußland fanden sie als Samisdat hingegen nur wenige Leser.
Ein zweiter Band ist mit einer ebenso symbolischen, doch weniger zuversichtlichen Überschrift versehen. Er heißt Hope Abandoned, so als ließe Nadeschda Mandelstam alle Hoffnung auf Rußland fahren. Sie starb 1980 mit 81 Jahren in Moskau.