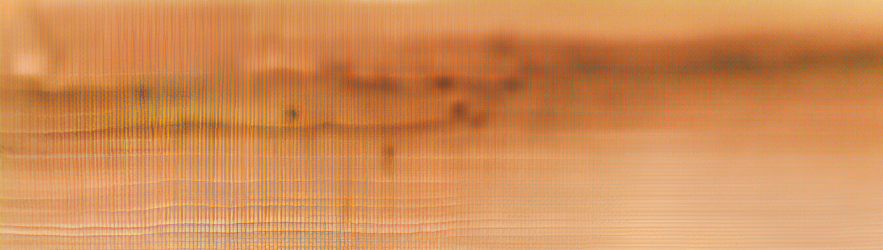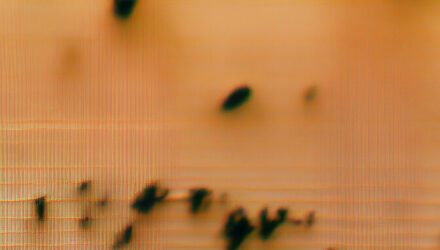Überlebenskünstlerin Ingeborg Bachmann
Es war kein Selbstmord. Sie hätte den Brand im Bett überlebt, wenn sie in der Klinik unverzüglich behandelt worden wäre. Das ist damals nicht geschehen. Erst nach 24 Stunden wurden Ingeborg Bachmanns Brandwunden versorgt, aber da war es zu spät.
Unter den vielen Legenden, die sich um ihr Leben ranken, ist diese nur die letzte.
Ja, ich habe sie gut gekannt, nicht nur bei den zufälligen Begegnungen, die das literarische Leben mit sich bringt. 1959 verbrachten wir ein gemeinsames Jahr in Rom. Sie war dort, soweit, wie es ihr möglich war, zu Hause; und mir war ein Aufenthalt in der Villa Massimo angeboten worden, von dem ich wenig Gebrauch machte. Wir sahen uns oft, in den Cafés an der Via Veneto, bei Hans Werner Henze oder auf der Insel Giglio, die damals noch nicht von Touristen bevölkert war. Wir hatten uns schnell darauf geeinigt, die meisten Themen einfach wegzulassen: die Hackordnungen im Literaturbetrieb, die Gerüchte und die vielen Liebhaber, die sie ertrug. Einer von ihnen war, glaube ich, ein Verschwörer aus Algerien, der gegen die französische Kolonialmacht kämpfte, andere waren Autoren oder Musiker. Auch Stars gab es, Mäzene und Beschützer. Von ihren wichtigsten Liebesbeziehungen zeugen die Briefwechsel mit Paul Celan und mit Max Frisch. Darüber schwieg ich mich aus, und das fand sie angenehm.
Dagegen die Gedichte! Nicht nur ihre eigenen, daneben auch die von Ungaretti, die sie übersetzte. Mit ihm ließ sie sich zu später Stunde sehen, in ein silbernes Paillettenkleid gehüllt. In irgendeiner Bar an der Piazza diskutierten wir über den Alexandriner, über die Oper, über Shakespeares Winters Tale, über den Krieg in Algerien, über Berlin, Klagenfurt oder Harvard, wohin Henry Kissinger sie 1955 eingeladen und geschleppt hatte. Wir waren uns bald einig über die Vorzüge des getreuen Siegfried Unseld, der sie von alten Verträgen loseiste und ihr in seinem Verlag eine sichere Bleibe bot.
Auch von ihren Fluchten, ihren Depressionen und von den langen Monaten, die sie in Kliniken und Sanatorien zugebracht hatte, ließ sie hie und da etwas durchblicken.
Einmal sind wir sogar miteinander auf Tournee in die deutsche Provinz gegangen. Nach dem zweiten Abend wurde sie in einem lärmenden Ratskeller ohnmächtig, so daß wir, sehr zu meiner Erleichterung, das ganze Unternehmen abbrechen mußten. Vorgetäuscht war ihre Schwäche nicht; denn sie hat zeitlebens an Schlaflosigkeit gelitten und war abhängig von Medikamenten und vom Alkohol.
Obwohl sie selten Geld hatte, waren Ingeborgs Adressen immer gut. Einmal teilte sie sich ein schönes Haus in Neapel mit Hans Werner Henze, später eines auf dem Aventino mit Max Frisch. Zwei Autoren in einer Herberge, das geht nicht immer gut. Auch wenn sie nicht auf ein und derselben Etage arbeiten, hören sie, wie einer von beiden etwas in seine Schreibmaschine hämmert, während der andere auf ein leeres Blatt starrt und nicht weiterweiß. So erging es Ingeborg in der Villa von Max Frisch.
In Berlin wohnte sie an der Koenigsallee und freundete sich mit Gombrowicz an, der ihren politischen Argwohn nur allzu gut verstand. Am Ende lebte sie ganz allein in der römischen Via Bocca di Leone. Geholfen hat ihr das alles nicht. Viele Dramen und Enttäuschungen hat sie überlebt. Ihr letztes großes Vorhaben, von dem nur der erste Teil zustande kam, trägt den ominösen Titel Todesarten. Es tut mir leid, daß ich Ingeborg mit einer bloßen Vignette nicht gerecht werden kann. Ihr Leben reicht für mehr als einen Roman, der hoffentlich nie geschrieben und nie in den Buchhandlungen liegen wird.
Einmal hat sie mir nach langem Zögern ein neues Gedicht anvertraut. Geschrieben hatte sie es 1964, gedruckt wurde es vier Jahre später. »Böhmen liegt am Meer« war ihr letztes veröffentlichtes Poem.
Ich will nichts mehr für mich. Ich will zugrunde gehen.
… Und irrt euch hundertmal,
wie ich mich irrte und Proben nie bestand,
doch hab ich sie bestanden, ein um das andre Mal.