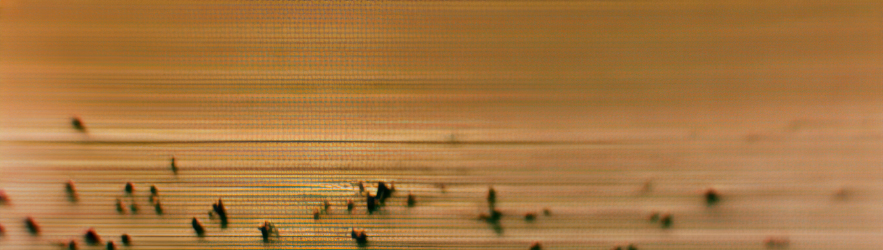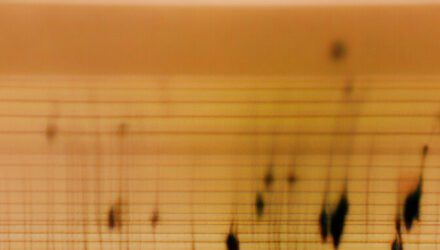Überlebenskünstlerin Ilse Aichinger
Günter Eich und Ilse Aichinger waren miteinander verheiratet und gehörten ein paar Jahre lang derselben Clique, der ziemlich überschätzten Gruppe 47, an. Aber ihre Ehe kann doch kein Grund sein, nicht beider zu gedenken!
Ilses Ruhm als Schriftstellerin war beträchtlich, ist aber dabei, allmählich zu verbleichen. Nur die Schulbücher bewahren manches, was sie schrieb, bis heute auf. Es kann sogar sein, daß aufgeweckte Kinder es lesen.
Vom Schreiben wollte sie nie leben. Lieber hätte sie einen anständigen Beruf ergriffen, wäre Ärztin geworden wie ihre Mutter, nur sei sie dafür leider »zu ungeschickt gewesen«.
Ihre leisen, aber entschiedenen Töne waren für die beiden verstörten Länder, in denen sie lebte, ein Segen. Denn schon die Namen, auf die man in Deutschland und in Österreich taufte, was geschehen war:
»Zusammenbruch«, »Stunde Null«, »Kahlschlag« und »Wirtschaftswunder«, waren alle nichtssagend oder falsch. Schuldgefühl und Trotz, Verlegenheit und Ressentiment ergaben einen schwer erträglichen Cocktail von kollektiven Neurosen. Es kann sein, daß Ilse Aichinger für den Westen Deutschlands unversehens zur Therapeutin wider Willen geworden ist, ganz ohne Approbation und Kassenpraxis. Woher denn ihr Lächeln komme, wurde sie einmal gefragt. Es komme, war die Antwort, von dem gewaltigen Zorn, den sie auf diese Welt habe. Der Welt Kontra zu geben, aber mit freundlichem Gesicht und sanfter Stimme, das war ihr künstlerisches Programm.
Ilse und ihre Schwester Helga Michie kamen als Zwillingstöchter eines Lehrers und einer jüdischen Ärztin in Wien zur Welt. Ihre Kindheit verbrachten sie in Linz. Nach der Scheidung der Eltern zog die Mutter mit den Kindern wieder nach Wien, wo Ilse bei ihrer jüdischen Großmutter oder in Klosterschulen lebte.
Nach dem Einmarsch Hitlers in Österreich war die Familie gefährdet. Die Nürnberger Gesetze hatten zur Folge, daß die Bevölkerung je nach ihrer Abstammung klassifiziert wurde. Es gab von nun an reine und fragmentarische Arier, Voll-, Halb- und Vierteljuden.
Die jüdische Gemeinde in London hatte seit 1938 mit dem Einverständnis der britischen Regierung Transporte organisiert, um gefährdete Kinder zu retten. Ilse Aichingers Schwester Helga konnte auf diese Weise nach Großbritannien fliehen. Aber dann brach der Krieg aus. Die Mutter verlor ihre Stellung als städtische Ärztin. Vor der Deportation war Ilse, weil sie als unmündige »Halbarierin« galt, vorläufig geschützt. Als sie volljährig war, versteckte Ilse ihre Mutter in einem Zimmer, das gegenüber dem Gestapo-Hauptquartier am Wiener Morzinplatz lag. Die Großmutter und die jüngeren Geschwister der Mutter wurden 1942 deportiert und kamen in einem weißrussischen Konzentrationslager ums Leben.
Nach der Befreiung begann Ilse Medizin zu studieren, brach aber nach fünf Semestern ihre Ausbildung ab.
»In der Küche einer armseligen Wohnung« und in »einer Anstalt für Unheilbare, Alte, Abgeschobene«, in der ihre Mutter nun als Ärztin arbeitete, schrieb sie ihren einzigen Roman, Die größere Hoffnung. Hans Weigel empfahl ihr, ihn an Gottfried Bermann Fischer zu senden, der das Buch gut fand und zuerst in Amsterdam verlegte.
Ilse Aichinger arbeitete als Lektorin, später auch an der Ulmer Hochschule für Gestaltung, die mit amerikanischer Hilfe von Inge Scholl, Otl Aicher und Max Bill gegründet worden war. 1951 lernte sie auf einer Tagung der Gruppe, immer derselben Gruppe, ihren Ehemann Günter Eich kennen. Das Ehepaar lebte mit den beiden Kindern erst in Oberbayern und dann in Großgmain bei Salzburg. Ihr Sohn Clemens wurde ebenfalls Schriftsteller und starb früh bei einem Unfall. Nach dem Tod ihres Mannes zog sich Ilse Aichinger aus der Öffentlichkeit zurück.
Eigentlich hat sie gar nicht so viel geschrieben. Ein paar Gedichte, Erzählungen, Hörspiele. In einem ihrer raren Interviews hat sie mit 75 Jahren Iris Radisch viel von dem verraten, was ihr wichtig war. In diesem Gespräch fiel auch der unerhörte Satz:
Der Krieg war meine glücklichste Zeit.
Ich war sehr jung und hatte die Gewißheit, daß meine Großmutter, die mir der liebste Mensch auf der Welt war, zurückkommt. Dann war der Krieg zu Ende, der Wohlstand brach aus, und die Leute sind an einem vorbeigeschossen. Das war noch schlimmer als der Krieg…
Ich hatte schon als Kind den Wunsch zu verschwinden. Das war mein erster leidenschaftlicher Wunsch… Ich habe es immer als eine Zumutung empfunden, daß man nicht gefragt wird, ob man auf die Welt kommen will. Ich hätte es bestimmt abgelehnt…
Auf die Frage, was ihre stärksten Erinnerungen an die Kindheit seien, antwortete sie:
Der Geruch von Weihrauch, gemischt mit Seifenlauge, mit der man die Steinböden in meiner Klosterschule aufgewischt hat. Den rieche ich, obwohl er nirgends mehr ist. Dann dieser Rauchgeruch, dieser Slumgeruch in England. Oder der Geruch von Baldriantropfen in alten Wohnungen. Und gewisse Nebeltage, wenn der Nebel so dicht wird, daß man den Blinden nachgehen muß, denn die gehen richtig.
Sie schrieb immer weniger, und ihre Texte wurden immer kürzer. Einen Sammelband von 1976 nannte sie Schlechte Wörter. Sie hat wahr gemacht, was sie sich vorgenommen hatte, als sie jung war:
Ich wollte am liebsten alles in einem Satz sagen.
In Wien ließ sie sich fast jeden Tag im Café Demel sehen. Ihre letzten Jahre verbrachte sie in einem Pflegeheim. Manchmal ließ sie sich vermummt in ihrem Rollstuhl durch die Gassen schieben. Sie wurde sehr alt und starb in der Stadt, wo sie geboren war.