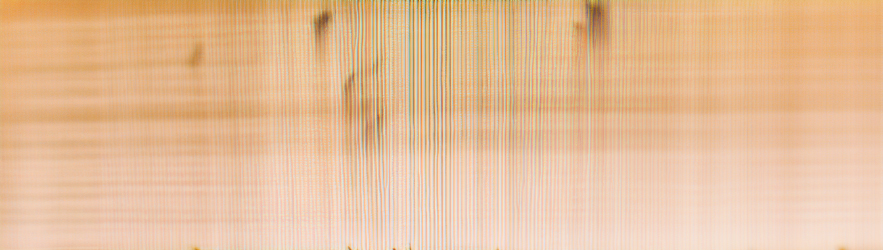Überlebenskünstler Anna Achmatowa
Wenn die Sizilianer ein Fest feiern, bringen sie einen Tag lang die Nöte der Insel zum Schweigen. Dann siegt der Pomp. Nachdem sie beschlossen hatten, einer 75jährigen russischen Dichterin einen Preis zu verleihen, fand die Zeremonie im Teatro Massimo Bellini zu Catania statt, und nicht nur eine Schar von Würdenträgern war anwesend, sondern auch Quasimodo, Ungaretti und Ingeborg Bachmann.
Anna Achmatowa, die unnahbare Königin der russischen Poesie, eine stolze, eher junonische als venusische Schönheit in langer Robe, trug eines Abends im Dezember 1964 zum Dank für den Ätna-Taormina-Preis ein paar ihrer Verse vor, und ich durfte ihr, Gott weiß warum, in einem weinroten Plüschsessel zuhören.
Untergebracht war man im San Domenico, einem ehemaligen Dominikanerkloster in Taormina, das zu einem Luxushotel umgebaut war. Ich habe es nicht gewagt, sie beim Diner anzusprechen.
Das war, bevor sie zwei Jahre später unweit von Moskau im Bett gestorben ist.
Es mag ja sein, daß Achmatowa eitel war, überheblich, eifersüchtig, klatschhaft und eigensinnig. Ihre engste Freundin Nadeschda Mandelstam deutet das in ihren Erinnerungen an, aber zugleich betont sie ihren Mut, ihre furchterregende Intelligenz und ihre Unbestechlichkeit.
Ein ruhiges Leben war ihr nie vergönnt, obwohl sie es als Kind gut hatte. Ihr Geburtsname war Anna Andrejewna Gorenko. Die Eltern lebten in Zarskoje Selo, der Sommerresidenz der Zaren, wo es Parks und Pferderennen gab, und den Sommer verbrachte sie auf der Krim. Mit elf Jahren fing sie an, Gedichte zu schreiben, was ihrem Vater nicht gefiel. Deshalb wählte sie von nun an das Pseudonym Achmatowa. Ihr Leitstern war Puschkin.
Nach der Trennung ihrer Eltern studierte sie in Kiew. 1910 heiratete sie Nikolai Gumiljow, das Haupt der Akmeisten, einer Petersburger Dichterschule, die aus einem Triumvirat bestand; der Dritte im Bunde war Ossip Mandelstam. Annas erster Gedichtband, der 1912 erschien, hieß Abend.
Nach der russischen Revolution verdüsterte sich ihr Leben. Sie ließ sich von Gumiljow scheiden, der 1922 wegen »konterrevelutionärer Tätigkeiten« erschossen wurde. Ihr zweiter Mann, ein Kunsthistoriker, fiel einer Säuberung zum Opfer und starb 1953 in Workuta, einem Arbeitslager.
Jahrzehntelang wurde nichts mehr von ihr gedruckt. Lew, ihr einziger Sohn, wurde mehrmals verhaftet und kehrte erst 1956 aus dem Gulag zurück.
1940 wurde auf persönlichen Befehl Stalins hin, der sie bewunderte und vielleicht beneidete, ihr Band Aus sechs Büchern veröffentlicht. Iossif Dschugaschwili, wie er ursprünglich hieß, hatte schließlich als 16jähriger Student am Tifliser orthodoxen Priesterseminar selber Gedichte verfaßt, die schlecht und bis zur Wehleidigkeit sentimental waren.
1950 mußte Achmatowa einen Zyklus zum »Ruhm des Friedens« veröffentlichen, darunter auch ein verspätetes Gedicht zum 70. Geburtstag Stalins, in dem es heißt:
Die Legende berichtet von einem weisen Menschen,
der uns alle vom Schrecken des Todes errettet hat.
War das eine Konzession, oder war es eine Anspielung auf den »Großen Vaterländischen Krieg«, der das deutsche Dritte Reich besiegt hatte?
Alles umsonst. 1946 erklärte ein gewisser Schdanow, ZK-Sekretär für Kultur und Ideologie:
Die Achmatowa ist eine wildgewordene Salondame, die sich zwischen Boudoir und Betstuhl bewegt… Halb Nonne, halb Dirne, bei der sich Unzucht und Gebet vermischen.
Die Folge war der Ausschluß aus dem Schriftstellerverband, was einem erneuten Schreib- und Publikationsverbot gleichkam. Ihrem Freund Pasternak erging es später ebenso. Anna mußte »von Brot und Tee« leben. Von da an lernte sie ihre Gedichte auswendig und verbrannte ihre Manuskripte. »Hände, Zündhölzer, ein Aschbecher – ein schönes und bitteres Ritual«, so schildert Lydia Tschukowskaja in ihren Erinnerungen diese Szene.
Aber dann kam plötzlich Isaiah Berlin zu einem denkwürdigen Besuch nach Leningrad, ein jüdischer Philosoph, in Riga geboren, der nicht nur Russisch sprach, sondern die Literatur und das geistige Klima des Landes in- und auswendig kannte. Er war damals Sekretär an der britischen Botschaft in Moskau. Für Achmatowa war das seit über 30 Jahren der erste Mensch aus dem Westen, ein »Gast aus der Zukunft«, dem sie in einer langen Nacht alles erzählte, was sie erlebt hatte. Berlin berichtet von dieser Begegnung in seinen Personal Impressions von 1980. Wer Achmatowa verstehen will, muß zu diesem Buch greifen, von dem auch eine deutsche Übersetzung existiert. Erst nach mehr als 40 Jahren sind Nadeschda Mandelstams verschollen geglaubte Erinnerungen an Anna Achmatowa ans Tageslicht gekommen, weil ein Typoskript bei einer Bekannten erhalten blieb. Die beiden Freundinnen verband nicht allein die Liebe zur Dichtung, die Erfahrung von Krieg, Terror und persönlichen Verlusten, sondern eine leidenschaftliche Beziehung zu Ossip Mandelstam.
Nadeschdas hingehauener Text ist provokant, illusionslos und manchmal geradezu zynisch. Sie sieht die russische Poesie der Moderne von ihrem Ehemann Ossip derartig beherrscht, daß ihm neben Pasternak nur Achmatowa das Wasser reichen könne. Blok, Chlebnikow und Majakowski fertigt sie als Kretins ab. Auch die Frau, mit der sie Verfolgung, Entbehrung und die Querelen der Dreisamkeit durchgestanden hat, schont sie nicht, sondern spricht von den weniger liebenswürdigen Zügen ihrer engsten Freundin, von ihrem Jähzorn, ihrer Rechthaberei und ihrer Unbarmherzigkeit. »Wie konnte es passieren«, fragt sie sich, »daß Anna, Ossip und ich, drei Dickschädel, drei Strohköpfe, drei unglaublich leichtsinnige Menschen, unseren Bund so lange aufrechterhalten haben?«
Wenn diese Vignette ein paar Zeilen länger als die anderen ausfällt, so liegt das daran, daß es hier um eine Frau geht, die das »Jahrhundert der Wölfe« unbesiegt überstanden hat.