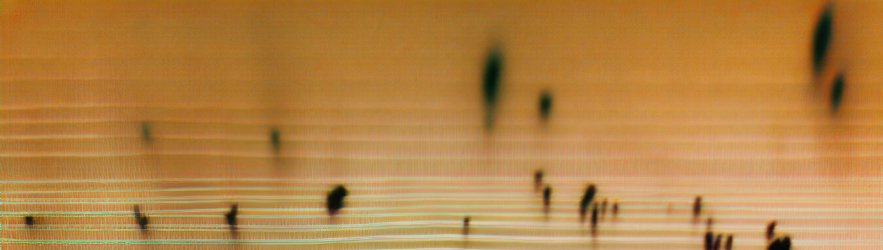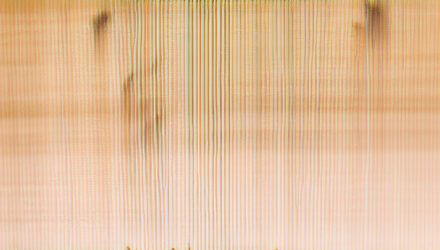Überlebenskünstler Octavio Paz
Auf einmal hatte das Iberoamerikanische Institut Geld. Das lag vielleicht daran, daß Willy Brandt Regierender Bürgermeister von Berlin war. Jedenfalls konnte das Institut es sich leisten, eine Schar von Schriftstellern aus der Neuen Welt einzuladen. Weil auch ich damals ein Berliner war und Spanisch sprach, durfte ich an diesem Treffen teilnehmen.
Unter den Gästen war einer, dessen Werk ich kannte. Ich hatte sogar ein paar seiner Verse übersetzt. Octavio Paz war eine vollblütige, stattliche Erscheinung mit kreolisch getöntem Teint. Dieser Weltbürger diente der mexikanischen Regierung als Diplomat.
Das war in Lateinamerika nichts Ungewöhnliches. Für einen Botschafter gehört es in diesem Teil der Welt, anders als bei uns, zum guten Ton, daß man Gedichte veröffentlicht. So hielten es Pablo Neruda, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier und viele andere.
Octavio Irineo Paz y Lozano wurde während der mexikanischen Revolution von 1914 in der Hauptstadt geboren. Sein Vater war ein Anhänger Zapatas und mußte wegen irgendwelcher Wirren nach Los Angeles emigrieren. Nach dem üblichen Bildungsgang fing sein Sohn an, Gedichte zu schreiben. Er weigerte sich, Jura zu studieren. Damals waren bürgerliche Familien darauf bedacht, daß ihre Söhne den Arzt- oder den Anwaltsberuf ergriffen. Octavio wollte aber unbedingt Dichter oder Revolutionär werden. Das zweite Ziel hat er verfehlt und das erste erreicht.
Es verstand sich von selbst, daß er im Spanischen Bürgerkrieg Partei ergriff. Mit dreiundzwanzig wollte er sich zur Republikanischen Armee melden. Er wurde abgelehnt, weil er politisch ein unbeschriebenes Blatt und nie einer Partei beigetreten war. Statt im Schützengraben landete er 1937 auf einem Kongreß antifaschistischer Schriftsteller, wo sich von Malraux bis Auden und von Neruda bis Hemingway alle Sympathisanten der Republik einfanden; sogar César Vallejo war dabei.
Was Octavio gar nicht gefiel, war allerdings der Bürgerkrieg im Bürgerkrieg, den die Kommunisten in Barcelona gegen die POUM anzettelten, weil das in ihren Augen Trotzkisten waren. Hier liegt einer der Gründe dafür, daß er mit der Kommunistischen Partei nichts zu tun haben wollte.
1945 begann er eine Diplomatenkarriere, die ihn nach Paris brachte, wo er sich mit Camus, mit den Surrealisten und sogar mit Breton anfreundete. Darauf folgende Stationen waren die Botschaften in Japan und in Indien.
Aus der mexikanischen Revolution ist allerdings im Lauf der Zeit eine einzigartige Partei hervorgegangen, die ihre Besonderheit schon in ihrem Namen trägt: Die PRI nennt sich nämlich »Institutionelle Revolutionäre Partei«. Von 1929 bis 2000 unterband sie jede oppositionelle Regung, die ihr gefährlich werden konnte. Ihre Macht war so groß, daß sie in der Lage war, auch die Intelligenz und die Kultur nach Belieben einzukaufen.
Mexikanische Universitäten und Museen wurden ausgebaut, ebenso wie der größte Verlag des Landes, bei dem die ganze Weltliteratur im Katalog steht. Dort mußte jeder angesehene mexikanische Autor publizieren. Auch Octavios Essay El laberinto de la soledad ist dort erschienen. Dieses Buch hatte er bereits 1950 in Spanien veröffentlicht. Es geht der Mentalität der Mexikaner auf den Grund, wurde zu einem Klassiker und brachte es zu einer Millionenauflage.
Einmal hat er mich in seine prachtvolle Wohnung am zentralen Paseo de la Reforma eingeladen. Selbst weniger wichtigen Intellektuellen stellte die PRI nicht nur einen Dienstwagen, sondern sogar einen Chauffeur zur Verfügung.
1962 wurde er zum Botschafter in Neu-Delhi ernannt. Dort schenkte er mir ein kostbares Exemplar seiner indisch angehauchten Gedichte, einen prächtigen Privatdruck in Großfolio, der heute bei mir im Keller liegt, weil er in kein Regal paßt.
1968 kam es zum Bruch mit der allmächtigen PRI, die in Tlatelolco auf protestierende Studenten schießen ließ und ein Blutbad anrichtete, das der mexikanischen Regierung die Olympiade verdarb. Octavio war der einzige, der daraufhin den diplomatischen Dienst quittierte. Viele Jahre hat er als Hochschullehrer in den USA verbracht. Geschadet hat ihm das nicht, ganz im Gegenteil. Nach seiner Rückkehr gründete er die liberale, um nicht zu sagen antikommunistische Zeitschrift Vuelta, was zu Wutausbrüchen der mexikanischen Linken führte.
Hochdekoriert, 1981 mit dem Cervantes-, 1990 mit dem Nobelpreis, ist er in seinem Haus in Coyoacán gestorben. Wem der Sinn danach steht, der kann ein paar Ecken weiter den Häusern Trotzkis, Frida Kahlos und Diego Riveras einen Besuch abstatten.
Einmal wurde Octavio gefragt, ob er dem 20. Jahrhundert etwas Gutes abgewinnen könne. Er antwortete:
Ich habe es überlebt. Das genügt mir… Die Geschichte ist das eine, sie war schlimm genug. Aber das Leben der gewöhnlichen Leute geht in den großen historischen Ereignissen nicht auf. Sie arbeiten, verlieben sich, werden krank, erfahren Augenblicke der Freundschaft, der Traurigkeit oder der Erleuchtung. Und das ist das Wichtigste.