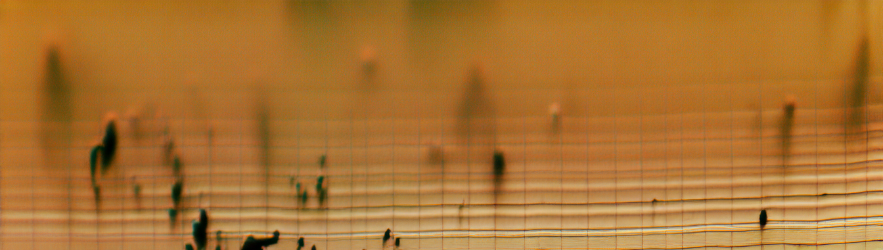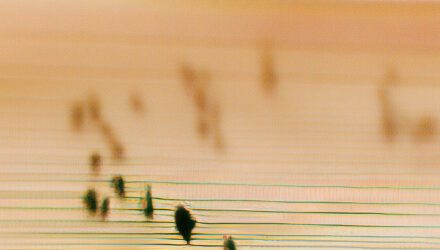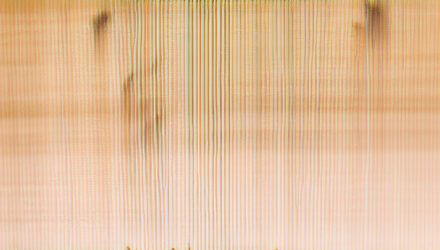Überlebenskünstler Joseph Brodsky
Auch ich gehörte in den sechziger und siebziger Jahren dem umherschweifenden Dichter-Club an, der sich bald in Lissabon oder London, bald in Kalifornien oder Stockholm traf, eingeladen von irgendeiner Stiftung, von einem wohlmeinenden Bürgermeister oder von der reichen Erbin eines Ölimperiums. Es gibt immer noch Menschen und Institutionen, die glauben, die Poesie fördere ihr Prestige. Woran das liegt, kann ich nicht sagen.
Man hörte sich bei solchen Veranstaltungen an, was die anderen vorlasen, und verbrachte lange Nächte in einer verräucherten Hotelbar. Auch wenn ich längst nicht mehr dazugehöre, gibt es wahrscheinlich solche Treffen nach wie vor.
So habe ich auch Joseph Brodsky öfters erlebt, zum ersten Mal, glaube ich, in Rotterdam. Sein Selbstbewußtsein war frappant. Er nahm Maß an Horaz und Vergil. Nur wenige seiner russischen Zeitgenossen fanden Gnade vor seinem Urteil: Achmatowa, Mandelstam und Zwetajewa. (Großzügiger verfuhr er mit Dichtern der englischen Zunge, wie Auden, Walcott, Frost oder Lowell.)
Einem Beichtvater wäre die Wahl zwischen seinen Todsünden leichtgefallen. Es war die superbia. Der Hochmut war seine Waffe, und er wußte sie zu gebrauchen. Nur hatte er keinen Pfarrer, der ihm die Absolution erteilt hätte. Er war ja Jude. »Ein schlechter Jude«, gestand er 1979 einem Besucher, denn er kämpfte nicht für das Judentum, sondern für die Sprache:
Für mich ist sie die einzige Gottheit.
Genauer gesagt, war es die Poesie. Die sei nicht bloß eine Kunst wie die anderen, sondern viel mehr: der höchste Ausdruck des Sprachvermögens, unsere anthropologische, genetisch verwurzelte Bestimmung. Warum die Amerikaner nicht, wie seinerzeit die Russen, zu großen Dichterlesungen strömten, konnte er sich einfach nicht erklären.
Die Moskauer Splitterrichter im Schriftstellerverband würdigte Brodsky keiner Zurechtweisung, und der Justiz, die ihm den Prozeß machte, begegnete er mit kaltblütiger Herablassung. Seine russischen Verse trug er mit der in Rußland herkömmlichen Emphase vor. Erst als er anfing, selber in steilem Englisch Gedichte zu verfassen, dämpfte er dieses Pathos. In die Sprache der Engländer war er geradezu verliebt; nötigenfalls übersetzte er sich selber.
In den siebziger Jahren hauste er im Greenwich Village. In seiner Wohnung häuften sich Papiere, Zettel und Bücher. Auf dem Kaminsims waren Photos von Anna Achmatowa, Auden, Spender und Paz zu sehen. Er war Kettenraucher.
Nadeschda Mandelstam hat diesem jungen Mann prophezeit, er werde ein böses Ende nehmen. Das steht im zweiten Buch ihrer Erinnerungen, Generation ohne Tränen. Was sein Verbleiben in Rußland angeht, hat sie damit recht behalten.
Iossif Alexandrowitsch Brodskij ist in Leningrad geboren. Seinen Vornamen verdankt er absurderweise Stalin. Mit 18 fing er an, Gedichte zu schreiben, aber »ein Rimbaud«, sagte er, »war ich damals nicht«. Erst später hat er mit seinen Gaben ernst gemacht. Er wohnte bei seinen Eltern in einer kommunalka. Während der Belagerung durch die deutsche Wehrmacht waren die Brodskijs nicht nur arm, sie wären fast verhungert. Die elterliche Wohnung in Leningrad hat er als seine private Höhle beschrieben, in einem denkwürdigen Aufsatz mit der Überschrift »In eineinhalb Zimmern«.
Er arbeitete als Maschinist, in einem Leichenschauhaus und auf einem Schiff Geologische Expeditionen, an denen er teilnahm, führten ihn in die entlegensten Gegenden der Sowjetunion. Als er zum ersten Mal verhaftet wurde, drohte ihm der KGB mit der Verbannung nach Sibirien. Das beeindruckte ihn nicht, weil er mit öden Zonen vertraut war.
Brodsky war ein großer Autodidakt. Englisch lernte er mit Hilfe eines Wörterbuchs. Ausländische Literatur verschaffte er sich aus dem Untergrund. Den Namen Eliot kannte er; der sei ein Markenzeichen wie Coca- Cola gewesen.
Schon 1936 gab es erste, unbeholfene Übertragungen seiner Gedichte. Sie aufzutreiben war nicht leicht; denn die Übersetzer wurden alsbald eingesperrt oder umgebracht.
Nach einer Pressekampagne, die seine Verse als pornographisch und antisowjetisch denunzierte, wurde er 1964 vor Gericht gestellt und als »Nichtsnutz und Parasit« zu fünf Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Sein Prozeß erregte großes Aufsehen, und seine Verteidigung wurde legendär. Nach 18 Monaten verbannte man ihn nach Archangelsk. Anna Achmatowa soll sich sehr für ihn eingesetzt haben.
1972 hat ihn das sowjetische Reich ausgebürgert. Ihm was sofort klar, daß er von Rußland für immer Abschied nehmen mußte.
Ich hatte keine Ahnung, wohin. Auf keinen Fall wollte ich nach Israel. Ich konnte ja kein Wort Hebräisch. Es war Auden, der mir zu einer Einladung nach London verhalf. Dort gab es ein Festival namens Poetry Internationale. Ich wohnte bei Stephen Spender.
Amerikanische Universitäten boten ihm eine Existenzgrundlage. Er war offenbar ein guter Lehrer. 1977 nahm er die Staatsbürgerschaft der USA an. Es folgten Schlag auf Schlag Bücher, Übersetzungen und Auszeichnungen. 1987 kam der Nobelpreis, eine Ehre, die er anstrengend fand. Er war nicht gesund. Seit Jahren hatte er mit Herzproblemen zu tun.
Seine idée fixe war, in Venedig zu leben, das ihn an Sankt Petersburg erinnerte. Daß die Stadt dabei war, langsam zu versinken, störte ihn nicht. Er fand sogar Gefallen an der Dekadenz. Auf Paläste legte er allerdings keinen Wert. Er begnügte sich mit einer bescheidenen Pension unweit der Accademia, 1996 starb er in New York an einem Herzinfarkt. Sein Grab liegt auf der Friedhofsinsel San Michele. Ich hoffe, daß man ihn dorthin nicht mit einem Motorboot gebracht hat, sondern nach venezianischer Sitte mit einer blumengeschmückten Trauergondel.
»I like the idea of isolation, I like being in exile«, soll er zuletzt gesagt haben.