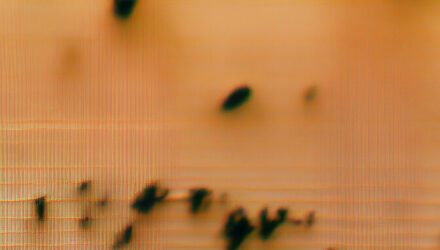Überlebenskünstler Heiner Müller
»Warum sprichst du so leise?« fragte ich ihn.
»Weil ich jedem etwas anderes erzähle.« Alles, was er gemacht hat, verdanke er Hitler und Stalin, versicherte Heiner Müller allen, die es hören wollten. Er war der einzige Schüler, der sich von Brechts Übermacht, der so viele anheimfielen, befreit hat.
Freundschaft war das nicht, was wir füreinander empfanden; wir fremdelten eher. Aber an Respekt und Bewunderung für seine Unverfrorenheit und seine Intelligenz hat es mir nie gefehlt.
Geboren ist er irgendwo in Sachsen. Den Vornamen Reimund legte er bald ab. Sein Vater war erst Sozialdemokrat und nach dem Krieg Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei. Heiner war in der Hitlerjugend und beim Reichsarbeitsdienst. Ist das wichtig? Muß man das wissen? Zeitungsbeiträge, Schriftstellerverbände, Selbstkritiken, Ausschlüsse, Rehabilitationen – alles spannend für die Beteiligten, aber leider auch öde.
Müllers Umsiedlerin wurde nach der Uraufführung 1961 sofort abgesetzt. Er flog aus dem Schriftstellerverband, was einem Berufsverbot gleichkam, und mußte sogar »in die Produktion«, was im Arbeiter- und Bauernstaat als strenge Strafe galt. Gegen Kritik war er unempfindlich. Er ließ sie an sich abtropfen. Einmal habe ich ihm gestanden, daß mir seine ersten Stücke die liebsten sind, Der Lohndrücker von 1956/57 und Die Korrektur. »Was du später gemacht hast«, beklagte ich mich, »war mir zu unverständlich und zu anstrengend.« Er war weit davon entfernt, beleidigt zu reagieren; er zog nur an seiner Zigarre und sagte:
Wahrscheinlich hast du recht.
Vielleicht erinnerte er sich daran, daß man ihn in der Bundesrepublik lange Zeit boykottiert hatte, oder daran, daß ich ihn als Dramatiker ernst genommen und 1966 ein Stück von ihm im Kursbuch gedruckt hatte. Zur literarischen Überlieferung hat er sich ausbeuterisch und produktiv verhalten. Er nahm sich, was er brauchen konnte, ohne Ansehen der Person. Shakespeare oder Anna Seghers, Hölderlin oder Erich Neutsch, Choderlos de Laclos oder Fjodor Gladkow, das galt ihm gleich.
Dann wurde er auf einmal »rehabilitiert«, bekam allerhand Preise, durfte schreiben, was, und reisen, wohin er wollte. Im kapitalistischen Westen machten seine Stücke bei wenigen Auserwählten enormen Eindruck, besonders in Paris und in den Vereinigten Staaten. Vielleicht lag das daran, daß Intendanten, Regisseure und Kritiker nicht wußten, was eine HAMLETMASCHINE sein soll und was er mit Leben Gundlings Friedrich von Preußen Lessings Schlaf Traum Schrei. Ein Greuelmärchen oder mit Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten eigentlich sagen wollte. Sie waren eingeschüchtert von der Mode, die dem Theater heilig ist, nicht zuletzt von Bob Wilsons Zauber- und Beleuchtungskunststücken und von Heiners orakelhafter Autorität.
Einmal traf ich ihn in New York an einer Tafel, wo ich einen Toast auf ihn ausbrachte, indem ich ihn seinen Bewunderern als den »führenden Sado-Marxisten« ans Herz legte.
Geradezu genial war er, wenn ihn jemand interviewte. Schlagfertig und ideologisch bedenkenlos rückte er mit Einsichten heraus, die niemand sonst riskierte. Es war ihm völlig egal, wenn er damit alte Freunde und vor allem die eigenen Genossen vor den Kopf stieß. Diese Gespräche mit Alexander Kluge, André Müller und Frank M. Raddatz gehören zu seinen größten Leistungen.
Es gibt auch Gedichte von ihm, die haltbarer sind als die Bricolage seiner späten Theaterarbeiten. An »3 Selbstkritik«, »Selbstbildnis zwei Uhr nachts« oder an »Mommsens Block« wird der Zahn der Zeit auch zukünftig noch viel zu nagen haben. Heiners Zynismus hatte seine Grenzen. Als ihm vorgeworfen wurde, er habe eng mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet, war er wirklich gekränkt und verfiel in eine Depression. Er ging sogar ausnahmsweise soweit, sich zu verteidigen. In der zweiten Auflage seines Buches Krieg ohne Schlacht: Leben in zwei Diktaturen erklärte er, daß er nur vorhatte, etwas gegen die »wachsende Hysterie der Macht« zu unternehmen.
Mit 65 Jahren ist er an Krebs gestorben. Sein Grab liegt auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin. Die Trauerfeier glich einem Staatsakt. Ein Defilee von Politikern und Künstlern stapfte durch den Schnee. Man verneigte sich und warf mit Blumen. Wolfgang, der jüngere Bruder des Dichters, hat zu dieser Zeremonie folgendes zu sagen:
Heiner wollte in New York oder in den Slums von Sao Paulo auf einer Müllkippe begraben sein. Wir haben ihn in ein offizielles Ehrengrab in Preußen gelegt. So wie ich Heiner kannte, glaube ich nicht, daß er dort liegenbleiben wird. Nur das Gras des Vergessens, das jetzt schon auf ihm wächst, würde ihm gefallen.