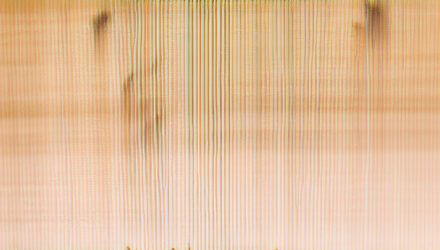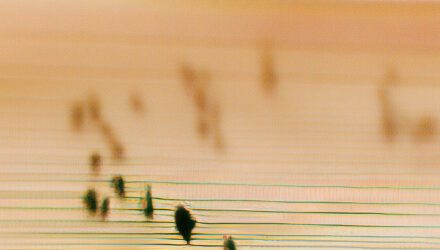Überlebenskünstler Günter Eich
Inventur hat er 1945 selbst gemacht, in einem berühmten Gedicht, das er im Kriegsgefangenenlager schrieb. Bei allen, die damals anfingen, ging es von Mund zu Mund. Günter Eich zählte auf, was sich in seinem Brotbeutel befand. Es war wenig. Neben einem Paar wollener Socken schleppte er allerhand mit sich, »was ich niemand verrate«.
Als diese Verse 1948 erschienen, gab der Titel Abgelegene Gehöfte nicht zu erkennen, was dem Publikum bevorstand. Fassungslos las man ein Gedicht, das »Latrine« hieß, und mußte zur Kenntnis nehmen, daß sich Hölderlin im Deutschen auf Urin reimt. Daß diese Verse später in allen Lesebüchern stehen würden, konnte sich niemand vorstellen, auch der Dichter nicht, dem seine Popularität immer lästiger wurde. Iris Radisch fand die glückliche Formulierung, Eichs Zeilen seien zu den »Merseburger Zaubersprüchen« der Nachkriegsliteratur geworden.
Günter Eich war in Lebus, nahe zur polnischen Oder-Grenze, geboren. In Berlin nahm er ein Sinologie-Studium auf, das er abbrach, um als freier Schriftsteller zu leben. Sein erstes Buch veröffentlichte er mit 18 Jahren unter dem lakonischen Titel Gedichte.
Nach 1933 ist er in Deutschland geblieben. Mit 26 Jahren wollte er Mitglied der NSDAP werden. Daraus wurde nichts, weil die Partei eine Aufnahmesperre verhängt hatte. Mit dem Radio, einem Medium, das damals eine enorme Reichweite hatte, kam Eich über die Runden. Angeblich schrieb er 150 Rundfunkmanuskripte, darunter auch viel Dutzendware. Was ihm wohl wie eine Nische vorkam, erwies sich mit den Jahren als Falle, weil er sich der Propagandamaschinerie nie ganz entziehen konnte.
Ende August 1939 wurde er zur Luftwaffe einberufen. Dem Einsatz an der Front entging er. Beschützt von seinem Vorgesetzten Jürgen Eggebrecht, mit dem er befreundet war, diente er bei der Zensurstelle für Wehrmachtsbüchereien in Berlin. Gegen Ende des Krieges war er Einsatzleiter bei der Luftverteidigung in Bayern und an der Ruhr.
Dann geriet er in amerikanische Gefangenschaft. Dort fing er sofort wieder an zu schreiben. Nicht nur der Lyrik, auch dem Rundfunk hielt er die Treue. Mit dem Hörspiel, dem er zu neuem Glanz verhalf, und dem Gedichtband Botschaften des Regens wurde er zu einem Star der sogenannten Gruppe 47, die ihm ihren ersten Literaturpreis verlieh. Zu den Verdiensten dieses Clubs gehört, daß er auf einer seiner Tagungen Ilse Aichinger kennenlernte, die er 1953 heiratete. Die beiden zogen nach Oberbayern und später ins Salzburger Land.
In den sechziger Jahren war die große Zeit des Hörspiels schon vorbei, und Günter Eich ließ kaum etwas von dem gelten, was er geschrieben hatte. Das letzte Mal, daß er sich zu allgemeinen Fragen geäußert hat, war bei der Verleihung des Büchner-Preises:
Nein, mich ergreift kein freudiger Schauer angesichts der Macht, ich finde sie abscheulich, wo immer sie beansprucht oder erlistet, erkämpft, erzwungen oder wohl erworben sei. Das Ach, das sie enthält, und die Nacht, auf die sie sich reimt, das ist sie: Der Seufzer und die Finsternis in unserm Leben.
Eher widerwillig sagte er denen, die ein Bekenntnis zum Abendland von ihm erwarteten, das erinnere ihn »an das dienstfreudige Gesicht, das ich einmal machen mußte«.
Er wußte nur zu gut, wovon er sprach. Seine erste Frau hatte sich umgebracht, und mit seiner Gesundheit stand es schon lange schlecht. Er war von Gelbsucht und Diabetes geplagt. Später erlitt er mehrere Herzattacken.
Im Alter wurde er gewissermaßen immer chinesischer. Darauf verstand er sich. Experten wie Annemarie Schimmel schätzten seine Übersetzungen von einem guten Hundert klassischer Gedichte, vor allem aus der Zeit der Han-, der Tang- und der Sung-Dynastien. Vielleicht hat er später auch noch Japanisch gelernt.
Jedenfalls ist er 1962 zum ersten Mal nach Tokio geflogen. Es kann sein, daß es dort Verlockungen gab, von denen man in Oberbayern, wo er wohnte, keine Ahnung hatte.
Er zog sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück und drückte sich immer elliptischer aus. »Jedes Gedicht ist zu lang«, behauptete er 1962. Sein liebster Gestus war das Abwinken. Mit »Zuversicht« überschrieb er die folgenden Zeilen:
In Saloniki
weiß ich einen, der mich liest,
und in Bad Nauheim.
Das sind schon zwei.
Immer rätselhafter wurden seine Maulwürfe, Texte, die zwischen Prosa und Poesie changieren, so wie Ein Tibeter in meinem Büro, das letzte Buch, das er zu seinen Lebzeiten gedruckt sehen wollte.
Nach langer, quälender Krankheit ist er in einem Salzburger Sanatorium gestorben.
Da der antifaschistische Eifer der Nachgeborenen bekanntlich nie erlahmt, ist er nach dem Tod vor ein Scherbengericht gestellt worden, das 1999 zusammentrat. Was man ihm vorwarf, war nicht neu. Schon seit Jahren war bekannt, daß er im Mai 1933 ein Beitrittsgesuch an die NSDAP gerichtet hatte, das abgelehnt wurde. Für die längst vergessenen Beisitzer stand das Urteil natürlich schon vor der Verhandlung fest: Er habe »bewußt für den NS-Staat optiert«, sei »Teil der NS-Propagandamaschinerie«, »opportunistisch«, »verantwortungs- und gewissenlos« gewesen. Daß Günter Eich sich zu seinem Verhalten schon früh geäußert hat, spielte keine Rolle. »Ich habe dem Nationalsozialismus keinen aktiven Widerstand entgegengesetzt«, bekannte er 1947. »Jetzt so zu tun als ob, liegt mir nicht.« Damit war für ihn alles gesagt.