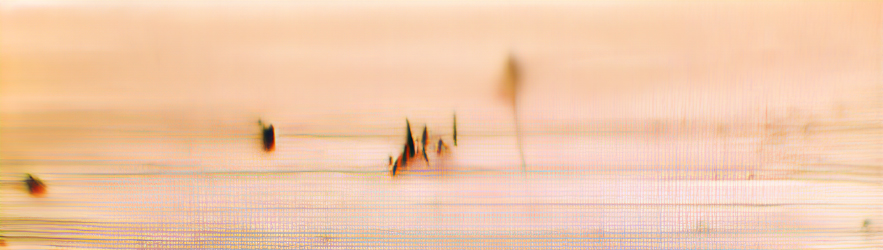Überlebenskünstler Gottfried Benn
Wie manche, die damals wie Peter Rühmkorf oder ich Gedichte lasen oder schrieben, kamen wir ohne Gottfried Benn nicht aus. Gewisse Verse von ihm waren wie eine Droge. Sie hatten einen ganz eigenen, unwiderstehlichen Sound. »Teils – teils das Ganze. Sela, Psalmenende.« – »Ich habe mich oft gefragt und keine Antwort gefunden, / woher das Sanfte und das Gute kommt, / weiß es auch heute nicht und muß nun gehen.« Wir konnten solche Zeilen auswendig hersagen.
Ich erinnere mich an einen glücklichen Raubzug an der Charing Cross Road in London, als ich im weitläufigen Labyrinth der Buchhandlung Foyles auf eine kleine, vergilbte Broschüre aus dem Jahr 1912 stieß. Der Titel lautete Morgue und andere Gedichte. Es war Benns erste, fulminante Publikation, die im Berliner Verlag von Alfred Richard Meyer erschien. Sie ist heute schwer aufzutreiben, weil die Auflage so klein war: 500 Exemplare, von denen die meisten längst zerfleddert sind. Damals kostete sie mich ein paar Schillinge, und ich fürchte, daß die Witwe eines deutschen Emigranten sie in die Regale von Foyles gebracht hatte, um ihre Miete zu bezahlen.
Das war Ende der vierziger Jahre, und ich wußte natürlich Bescheid über Benns politische Unzurechnungsfähigkeit, die er 1933 bewiesen hatte. Er war, wie Helmut Lethen sagt, »ein nützlicher Idiot des Umsturzes«. Als ein Publikationsverbot gegen ihn erging, legte er mehr Hellsicht an den Tag. Die Reichsschrifttumskammer nannte er ein »ästhetisches Sing-Sing«.
Er gab seine Kassenpraxis auf und zog sich als Oberstabsarzt in die Armee zurück, was er als die »aristokratische Form der Emigration« betrachtete. Nach dem Mord an Röhm und Schleicher hat er diese Zeit als Doppelleben beschrieben. Er lebte zuerst in Hannover und Berlin, später in Landsberg an der Warthe, einer Stadt, die heute auf polnisch Gorzów Wielkopolski heißt.
In privaten Briefen riskierte er Äußerungen, die nicht ungefährlich waren. An eine Freundin schrieb er: »Wie groß fing das an, wie dreckig sieht es heute aus«, oder: »Was nicht direkt ins KZ Lager führt, ist albern… Mit Papier kommt man Bestien nicht bei.«
Wie viele andere war ich, was ihn betraf, hin- und hergerissen zwischen Bewunderung und Ärger. Benn hielt sich für einen »Intellektualisten«, aber damit war es nicht weit her. Manchmal wäre er lieber »ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor« gewesen. Gern fuhrwerkte er mit Fremdwörtern herum, deren Klang ihm gefiel, ohne daß er ihre Bedeutung verstand. »Mich sensationiert eben das Wort ohne jede Rücksicht auf seinen beschreibenden Charakter rein als assoziatives Motiv«, teilte er mit.
Das Wort »Megalithkultur« gefiel ihm so gut, daß es ihm egal war, ob in dieser Zeit »Urjäger« oder Ackerbauern lebten. »Autopsychisch solitär, faulig monokol« – das ist doch Quatsch mit Soße! Vor solchen Unfällen hätte ihn jedes Wörterbuch bewahren können. Er konnte kein Englisch, reimte »Drogenflipp« auf
»der letzte Ship« und sprach die Fifth Avenue aus, als ob sie ›Feifs‹ hieße. Die Südsee, die er nur aus der Berliner Illustrirten kannte, riß ihn zu schwärmerischen Strophen hin. Seinen getreuen Bremer Freund Friedrich Wilhelm Oelze schätzte er als idealen Gentleman ein, eine »Synthese aus Oxford und Athen«.
Viele seiner Gedichte streifen den Kitsch, und dies bei einem Dichter, der sagte, es komme nur darauf an, ein paar »hinterlassungsfähige Gebilde« hervorzubringen. Wenn es hochkomme; sei das ein halbes Dutzend. Von Benn gibt es deren mehr als alles, was von den meisten Lyrikern übrigbleibt. Es sind besonders die aus seinen letzten Jahren. Er hörte lieber irgendeinem Schlager aus dem RIAS oder einer Unterhaltung am Nebentisch zu als einer Symphonie von Beethoven in der Philharmonie.
Seine Biographie ist gründlich erforscht. Dabei hat sich besonders Holger Hof hervorgetan, der in seinem Buch Der Mann ohne Gedächtnis minutiös auf die medizinischen und erotischen Seiten dieses Lebens eingeht. An Quellen dafür fehlt es nicht. In mehreren Briefwechseln findet, wer daran Anteil nehmen möchte, genügend Auskünfte über Eifersuchtsdramen, fatale Krankheiten, Selbstmorde und Todesfälle in Benns nächster Umgebung.
Obgleich er wahrhaftig nicht als Idealfigur oder gar als Schönling gelten konnte und kein Hehl daraus machte, daß er bindungsscheu und notorisch untreu war, verfielen ihm die Frauen reihenweise, ein Beweis dafür, daß die Frage »Was will das Weib?« ziemlich schwer zu beantworten ist.
Zuweilen überkam mich das Gefühl, daß ich es mir mit diesem Mann zu leicht gemacht hatte. Einmal fühlte ich mich veranlaßt zu rufen:
Laßt mir Herrn Dr. Benn in Ruhe!
Belle-Alliance-Straße, alle Kassen.
Seine Patienten haben sich nie über ihn beklagt.
Als während des Berliner Spartakisten-Aufstands ein paar verwundete Kommunisten bei ihm läuteten, hat er ihnen, ohne nach ihren politischen Ansichten zu fragen, Hilfe geleistet. Die Huren, die zur Kundschaft seiner Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten gehörten, behandelte er umsonst, wenn sie kein Geld hatten.
Ich will weiter meine Tripper spritzen, zwanzig Mark in der Tasche, keine Zahnschmerzen, keine Hühneraugen, der Rest ist schon Gemeinschaft, und der weiche ich aus.
Das war leichter gesagt als getan. Übrigens war Benn, so wie Karl Marx, mit dem er ansonsten nicht die geringste Ähnlichkeit hat, ein begnadeter Schimpfer. Über den Lyriker Wilhelm Lehmann: »Dagegen ist eine Schnecke ein Wirbeltier«; über Hofmannsthal: »Ein Schieber, Bankierssohn, mit sehr viel gepumpten Beständen«, und über Ernst Jünger: er habe »in genügender Menge das Mulmige, ohne das die Deutschen den Geist nicht ertragen», er sei »weichlich, eingebildet, wichtigtuerisch und stillos. Sprachlich unsicher, charakterlich unbedeutend«. Zu Strindberg fiel ihm ein:
Er will die Frau ›emporziehn‹ (statt: sie auszuziehn) u. muß ihr imponieren (mit geschmackvoll arrangierten Butterdosen und Frühstücksdecken)!… »Am Weibe zu Grunde gehn«, das ist doch schon geradezu sehr lieb!
Irgendwo muß in einer Mappe ein Brief von ihm stecken, der an mich als angehenden Rundfunkredakteur adressiert war. Es lohnt sich nicht, ihn herauszusuchen, denn er enthielt nur eine höfliche Absage und keinen der flotten Sprüche, mit denen er maskierte, wie schwer ihm der Preis zusetzte, der für sein Überleben und seinen späten Triumph fällig wurde. Bei aller Liebe tut, wer ihm, wie ich, viel zu verdanken hat, gut daran, sich beizeiten aus seinem Bannkreis zu befreien.