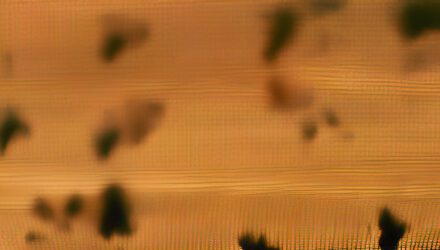Überlebenskünstler Fernando Pessoa
Er war der Meister der Tarnkappe. Er trug nicht nur eine, sondern eine stattliche Zahl solcher Kopfbedeckungen: Alexander Search, Robert Anon, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Antonio Mora, Bernardo Soares. Als Pseudonyme kann man diese Namen kaum bezeichnen.
Denn Fernando Antonio Nogueira de Seabra Pessoa hätte sich gegen bloße Decknamen gesträubt. Seine vielen Doppel- oder Vielfach-Autoren versah er mit Heteronymen. Jeden stattete er mit eigenem Stil, eigener Biographie, eigenen Vorzügen und Defekten aus. »Sei vielgestaltig wie das Weltall!« rief er. Wo aber ist Pessoa ipse, wo ist er selbst in diesem Varieté geblieben? »Uma pessoa« heißt in der Landessprache lediglich »eine Person«. Es ist ein Familienname, der so gut wie nichts besagt. Das Auffälligste an Pessoa war seine Unauffälligkeit. Man muß sich ihn als kleinen, schnurrbärtigen, bebrillten Herrn vorstellen, der sich mit immer demselben Hut in der Baixa, der Unterstadt von Lissabon, im selben Café einfindet und von dem die Welt kaum Notiz nimmt. Frauen spielen in seinem Leben keine Rolle. Er fristet sein Leben als Übersetzer. Für irgendwelche Firmen der Hauptstadt besorgt er die Handelskorrespondenz, eine mühsame und langweilige Arbeit, die ihm aber das sichert, worauf er am meisten Wert legt: seine Unabhängigkeit. Er hat immerzu geschrieben, aber wenig publiziert. Seine Manuskripte blieben liegen, »für die Truhe«, wie er sagte. Sein Nachlaß war ein Durcheinander, das den Philologen viel Kopfzerbrechen bereitet hat. In seinen postumen Werken wühlen sie bis heute.
1904 begann er zu dichten, und zwar auf englisch. Das liegt daran, daß seine Mutter einen portugiesischen Diplomaten geheiratet hatte, der in der britischen Kapkolonie als Konsul tätig war. Dieser Stiefvater schickte ihn auf die University of Cape Town, wo er sich in Shakespeare, Shelley, Keats und Poe vertiefte.
Dann ging die Familie nach Portugal zurück. Bald zeigte sich, daß dieser Jüngling über die Maßen begabt und gefährdet war. Er schrieb von nun an auf portugiesisch. Das Englische war nur noch ein Hintergrundrauschen. Auf ein politisches ›Engagement‹ ließ er sich nicht ein.
War er bescheiden? Das kann man dem jungen Mann nicht vorwerfen. Er träumte davon, Camões, den größten Klassiker des Landes, zu übertreffen. Über Widersprüche war er erhaben. Tradition und Avantgarde,
»Sensacionismo« und Astrologie, Mystik und Anarchie, das alles spukte in seinem Kopf herum. Er verfaßte: Lieder, Sonette, Oden, ein Versepos oder auch einen kleinen Roman. Eigentlich war Portugal zu klein für ihn, ein Land, das von seiner vergangenen Größe träumte und, wie er meinte, »von Bonzen regiert« wurde.
Gedichte interessierten ihn weit mehr als die Politik, obwohl er einmal sogar in einer Flugschrift die Militärdiktatur in Portugal verteidigt hat. Daß der Dichter ganz dicht war, daran sind Zweifel erlaubt. Er war zeitweise völlig auf den sagenhaften König Sebastião, auf Schopenhauer, die Rosenkreuzer, die Freimaurer, den Futurismus und die Alchemie fixiert.
Einer seiner Übersetzer hat erklärt, worin für Pessoa die Dummheit bestand. Blöde war es, die Spannung von Gegensätzen, von Anderssein nicht zu ertragen. Manchmal hatte er Angst, verrückt zu werden. »Ich war immer nur eine Spur und ein Trugbild meiner selbst«, sagt über ihn der Hilfsbuchhalter Bernardo Soares, eine der vielen Masken Pessoas, im Buch der Unruhe, das als sein Hauptwerk gilt, obwohl es nie so gedacht war, sondern aus der Truhe zusammengeflickt werden mußte. Ein großes Kapitel trägt die Überschrift »Autobiographie ohne Ereignisse«.
Pessoa verstarb mit 47 Jahren an einem Leberleiden in Lissabon, das er seit 1914 nie mehr verlassen hat.