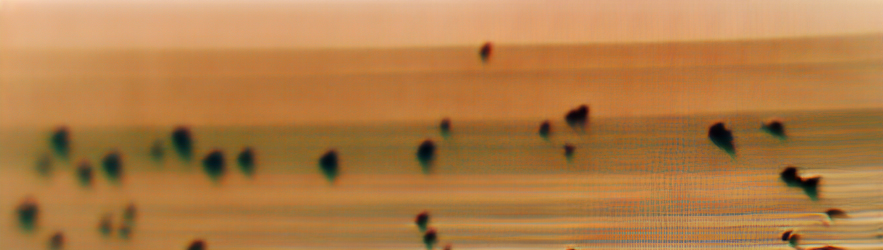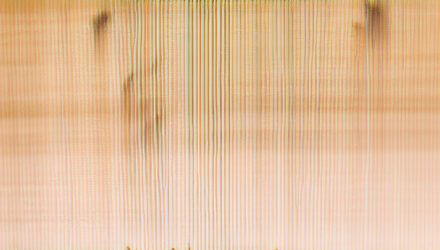Überlebenskünstler Czesław Miłosz
Ein Rechthaber war er nicht, aber ob die Heutigen es wahrhaben wollen oder nicht: Er hat mit dem, was er sagte, öfters recht behalten. Nicht allen paßte das; denn den Skeptikern war Czesław Miłosz zu katholisch, den Linken zu skeptisch, den Ignoranten zu gelehrt und den Polen nicht polnisch genug.
War es ein russisches, ein polnisches Dorf, wo er geboren wurde?
Nein, ich bin weder Pole noch Litauer, sondern Bürger des Großfürstentums Litauen, eines Reiches, das einst von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichte und in dem viele Völker lebten.
Solche Sätze waren von Miłosz zu hören.
Ich bewohne also ein Land, das schon lange verschwunden ist. Allerdings verstehe ich kein Wort Litauisch, weil mein Vater Pole war. Ich lernte Russisch, Englisch und Französisch und habe immer nur auf polnisch geschrieben. Aber die Landschaft, in der ich aufgewachsen bin, hat mich ein Leben lang begleitet.
Ein autobiographisches Werk, Das Tal der Issa, sein einziger Roman, legt von seiner Jugend Zeugnis ab.
»Die Sprache«, versicherte er, »ist meine einzige Heimat.«
Obwohl er katholisch erzogen wurde, brachte ihn seine Liebe zur Natur und zur Wissenschaft vom Glauben ab und machte ihn zum Atheisten. Aber auch dabei blieb es nicht. In Paris begegnete er 1931 seinem Cousin Oscar Miłosz, der Gedichte auf französisch schrieb und ein Anhänger Swedenborgs war. Czesław studierte Jura in Wilna, doch metaphysische und theologische Fragen ließen ihn nicht los. Er arbeitete beim polnischen Rundfunk, wurde aber entlassen, weil er den einen als zu links und den anderen als zweifelhafter Patriot galt. Er schrieb Gedichte; ein erster Band erschien 1933.
Den Zweiten Weltkrieg erlebte er in Warschau. Er mußte sich als Hausmeister an der Universitätsbibliothek durchschlagen und schrieb Artikel für die illegale Presse. Von der »Heimatarmee«, die das deutsche »Generalgouvernement« mit Waffengewalt besiegen wollte, hielt er sich ebenso fern wie vom Warschauer Aufstand, den er für leichtsinnig und aussichtslos hielt. Jüdischen Familien half er mit Geld aus und verschaffte ihnen Verstecke. Heute betrachtet man ihn deshalb als »Gerechten unter den Völkern« und gedenkt seiner in Yad Vashem.
Nach dem Krieg diente er der »Volksrepublik« als Kulturattaché in Washington und in Paris. Im Milieu der polnischen Emigration hat man ihm auch das verübelt. Umgekehrt mißfiel es vielen, daß er 1951 genug vom Stalinismus hatte und in Frankreich um Asyl bat. Camus verstand seine Gründe, aber Neruda und Picasso warfen ihm Antikommunismus und Fahnenflucht vor.
Darauf antwortete er mit seinem berühmtesten Essay: Verführtes Denken untersucht das Verhalten Intellektueller in einem totalitären System. Miłosz spielt das an einigen Varianten durch, die er in Polen an Hand von anonymisierten Beispielen beobachten konnte. Seiner Analyse zufolge sind es nicht allein Repression, Zensur und ökonomische Zwänge, die zur Unterwerfung führen. Auch Bequemlichkeit und Angst vor der Isolation bringen viele Intellektuelle dazu, dem Herdentrieb zu folgen, statt eine scheinbar aussichtslose Rebellion zu riskieren.
»Um Dissident zu werden«, sagte Miłosz, »braucht es keine überlegene Intelligenz, sondern einen Magen, der bei ideologischer Schonkost zum Erbrechen neigt.« Natürlich konnte ein solches Buch in Polen nicht erscheinen, sondern nur in Paris, wo die führende Exil-Zeitschrift Kultura es verlegte.
Er hatte kein Geld und versuchte, weil er sich in Paris nicht wohl fühlte, in die USA zu gelangen. Zur Zeit von McCarthy wurde sein Asylantrag abgewiesen. Erst als die Universität von Kalifornien ihn 1960 nach Berkeley berief, konnte er aufatmen. Dort lehrte er 20 Jahre lang Slawistik und Literatur, schrieb und übersetzte, was ihm gefiel, und wurde amerikanischer Bürger. Dann kam der Nobelpreis für Literatur. Ein Jahr später hat er wieder polnischen Boden betreten. Nun wurde er überschwenglich begrüßt. Seitdem lebte er auf zwei Kontinenten, abwechselnd in Berkeley und Krakau.
Einen ekstatischen Pessimisten hat man ihn genannt, und einen Apokalyptiker mit idyllischen Vorlieben. Joseph Brodsky hielt ihn für »einen der größten, vielleicht den größten Dichter unserer Zeit«. Er war ein fremdenfreundlicher, toleranter Melancholiker, der das deutsche und das sowjetische Reich überlebte. Daß er mit dem heutigen Polen zufrieden wäre, ist schwer zu glauben.
Czesław Miłosz starb mit 93 Jahren zu Hause. Er wurde in der Krypta der Königlichen Basilika und Erzkathedrale von St. Stanislaus und St. Wenzel beerdigt. Dagegen protestierten aufgebrachte Krakauer, die ihn für einen Gegner Polens, der Kirche und für einen Beschützer der Homosexuellen hielten. Erst als Papst Wojtyła und der Beichtvater des Schriftstellers den Frömmlern versicherten, daß er die Sterbesakramente empfangen hatte, ist Ruhe eingekehrt.