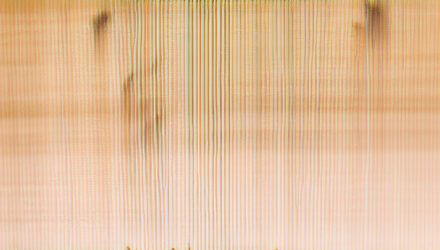Überlebenskünstler César Vallejo
Ich werde sterben in Paris, mit Wolkenbrüchen,
schon heut erinnre ich mich jenes Tages.
Ich werde sterben in Paris, warum auch nicht,
an einem Donnerstag vielleicht, wie heut, im Herbst.
Tot ist César Vallejo… Die Donnerstage
sind seine Zeugen, Zeugen seine Knochen,
der Regen, die Verlassenheit, die Straßen…
César Abraham Vallejo Mendoza, von dem dieses Gedicht stammt, ist in Santiago de Chuco geboren, einem Ort, der über 3.000 Meter hoch in einem Seitental der peruanischen Anden liegt. Die Reise nach der Hauptstadt Lima kostet leicht mehrere Tage. Vallejos Großmütter waren Indios vom Stamm der Quechua, seine Großväter Priester aus dem spanischen Galicien. Er war das jüngste von elf Geschwistern. Mit 19 Jahren tauchte er in den Städten auf, ein melancholischer Mestize, mager, dunkelhäutig, schwarz gekleidet, mit einer riesigen, pechschwarzen Mähne, das Gesicht beherrscht von großen Augen, die wie Tollkirschen glänzten.
Seine Eltern wollten einen Pfarrer aus ihm machen. Liturgische und biblische Motive finden sich in seinen ersten Versen, ebenso wie »abergläubische« Vorstellungen aus dem Erbe der Indios. Er brachte es nie ganz zum lupenreinen Atheisten. César ging in die Schule, aufs Gymnasium und fing 1913 ein Studium in der Großstadt an, das er mit einer Studie über die romantische Dichtung Spaniens abschloß. Um 1915 gab es in Peru, wie in ganz Lateinamerika, Dichter zu Dutzenden. Aber als sein erstes Buch, Die schwarzen Boten, in Lima erschien, verstand niemand seine chaotische Kraft, seine Obsessionen und seinen grenzenlosen Pessimismus.
Sein Anzug glänzte, weil er zu oft gebügelt worden war. Er hatte kein Geld. Sein Brot verdiente er als Lehrer an einer Abendschule und als Buchhalter auf einer Zuckerrohrplantage.
1920 wurde er in Santiago de Chuco verhaftet und in ein Gefängnis in Trujillo gebracht. Der Vorwurf lautete, er habe sich an einem politischen Aufruhr beteiligt. Weil dafür keine Beweise vorlagen, wurde er auf freien Fuß gesetzt. Doch das Gerichtsverfahren schleppte sich hin. Erst 1926 endete es in Abwesenheit des Beschuldigten mit einem Freispruch. Inzwischen hatte sich Vallejos Name im Klima der provinziellen Avantgarde von Lima herumgesprochen. Er war berüchtigt. Das genügte schon fast, um ihn zu einer Berühmtheit zu machen. Dazu trug sein zweiter Gedichtband bei, der den Titel Trilce trägt. Ein Buch der Revolte, der bodenlosen Grübelei und der selbstquälerischen Enttäuschung. Unerhört war seine Sprache, eine Fusion der Alltagsrede auf der Straße mit raffinierten technischen Mitteln, die an Quevedo und Góngora erinnern. Paris galt damals bei der südamerikanischen Intelligenzija noch als unwiderstehlicher Attraktor.
1928 wanderte Vallejo nach Frankreich aus. Es war für ihn eine Reise ohne Wiederkehr. Um zu überleben, blieb ihm nichts anderes übrig, als hastig Hunderte von Zeitungsartikeln für wechselnde Auftraggeber zu schreiben. Verschmierte Treppenhäuser, schmutzige Bidets, Petroleumkocher in winzigen Zimmern, das war die Misere, die Paris für ihn bereithielt. Manchmal wußte er abends nicht, wo er übernachten könnte.
Nach einer Reihe von unglücklichen Liebesgeschichten traf er eine Frau, die ihm durch alle Wechselfälle hindurch treu geblieben ist: die 19jährige Georgette Travers. Debatten über den Surrealismus in der Rotonde, wo er Tristan Tzara, Vicente Huidobro und Pablo Neruda begegnete, konnten ihn über den Pariser cafard nicht hinwegtrösten. Schon eher gelang das dem Magnetismus der kommunistischen Verheißung. Obwohl er der Partei nie beitrat, faszinierte ihn die Sowjetunion, die er 1928 zum ersten Mal besuchte. 1929 wurde er als »unerwünschter Ausländer« aus Frankreich abgeschoben und ging mit Georgette nach Madrid.
Dort erlebte er den Sturz der Monarchie und den Sieg der zweiten spanischen Republik und freundete sich mit García Lorca, Rafael Alberti und Antonio Machado an. Er schrieb das einzige seiner Bücher, das zu einem verlegerischen Erfolg wurde: Rußland 1931. Reflexionen am Fuße der Kremlmauer.
Nach dem Sieg der Volksfront unter Leon Blum kehrte er nach Paris zurück. Die Poesie, die er fast vergessen hatte, brach sich wieder Bahn, als die Falange den Spanischen Bürgerkrieg anzettelte, den General Franco mit der Niederlage der Republik beendete. Um dieses Martyrium kreiste Vallejos nächste Gedichtsammlung, die Poemas humanos, ein extremes Werk, das Pathos, Schmerz und Humor zugleich auf die Spitze treibt, so als hätten sich alle Furien seines Lebens am Bett des kranken Dichters eingefunden.
Es war kein verregneter Donnerstag, sondern der Karfreitag des Jahres 1938, als Vallejo in eine Klinik am Boulevard Arago eingeliefert wurde. Auf eine Diagnose konnten sich die Ärzte nicht einigen. »Todesursache unbekannt« heißt es in den Akten. In Wahrheit wird er an einer Krankheit gestorben sein, die älter ist als die Medizin: am Hunger.
Seine Witwe Georgette hat Césars Manuskripte durch alle Fährnisse der Schlamperei und der deutschen Okkupation gerettet. Ausgerechnet die Päpstliche Katholische Universität gab eine 14bändige Gesamtausgabe von Vallejos Werken heraus, die von 1997 bis 2003 in Lima erschienen ist.