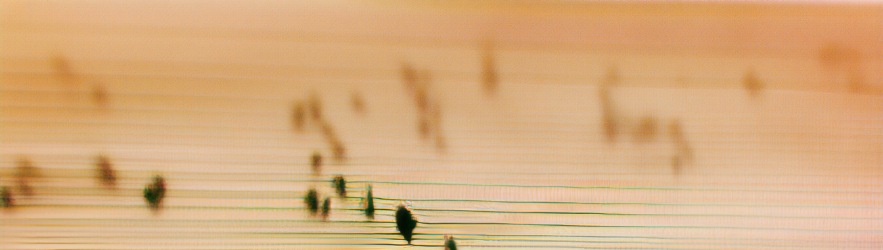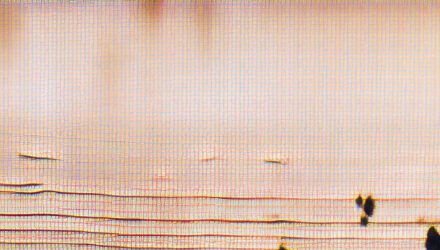Überlebenskünstler Boris Pasternak
Es kommt selten vor, daß ein Philosoph, der Gedichte verfaßt, als Mittfünfziger einen Roman schreibt, den plötzlich die ganze Welt kennt und liest. In Stockholm leuchtet man ihm mit einem Nobelpreis heim; daraufhin wird er zu Hause wüst beschimpft, darf nicht nach Schweden fahren, zieht sich auf seine Datscha, zurück und stirbt dort mit 70 Jahren im Bett. Boris Pasternaks Begräbnis wird von der Regierung ignoriert. Die Frage, wie der Dichter das alles überlebt hat, läßt sich natürlich auf ein paar Seiten nicht beantworten. Darüber und über sein Werk sind viele dicke Bücher geschrieben worden.
Geboren wurde Pasternak als Sohn jüdischer Eltern in Moskau. Sein Vater Leonid war Maler, seine Mutter eine bekannte Pianistin. Eigentlich wollte er Musiker und Komponist werden, wandte sich aber der Philosophie zu und ging nach Marburg, wo Hermann Cohen und Nicolai Hartmann, die Neukantianer, den Ton angaben. Er lernte Deutsch und fing an, Gedichte zu schreiben. »Wer sich ausschließlich mit Philosophie beschäftigt«, sagte er, »kommt mir vor wie ein Mensch, der nur Meerrettich ißt.«
Damit war er nicht allein. In Rußland gab es vor dem Ersten Weltkrieg Symbolisten, Futuristen und sogar eine »Linke Front der Künste«. 1914 erschien Pasternaks erste Gedichtsammlung, Zwilling in Wolken. Der Wehrdienst blieb ihm wegen einer Verletzung erspart. 1917 hatte er nichts gegen die Oktoberrevolution einzuwenden. Seine Eltern und Geschwister sind vier Jahre später nach Deutschland ausgewandert.
Er arbeitete als Bibliothekar, schrieb weiter seine Gedichte: Meine Schwester, das Leben und Das Jahr 1905. Mit diesen Publikationen wurde Pasternak zu einem der wichtigsten Dichter der russischen Moderne. Ilja Erenburg, der viel von einer Plaudertasche hatte, erzählt in seiner Autobiographie Menschen Leben Jahre:
Innerhalb von vierundzwanzig Jahren traf ich mich mit ihm, manchmal nur selten, manchmal fast täglich. Er erschien mir oft rätselhaft wie am ersten Tag.
Er habe an Schlaflosigkeit gelitten, sei egozentrisch, aber gesellig gewesen, vertraut mit Majakowski, Mandelstam, Babel, Paustowski, Schklowski und der Zwetajewa. Von seinen früheren Büchern habe er am Ende nichts mehr hören wollen und nur noch seinen Doktor Schiwago gelten lassen. Ehrenburg bewunderte seine Gedichte, wenngleich sie sich der Doktrin des Sozialistischen Realismus widersetzten.
Pasternak fristete sein Leben mit Übersetzungen aus dem Französischen, Englischen und Deutschen, darunter Goethes Faust, mehrere Tragödien von Shakespeare und Werke von Rilke und Kleist. Als er 1934 eine zweite Ehe einging, zog er mit seiner neuen Familie in die berühmte Künstlerkolonie Peredelkino in der Nähe von Moskau.
Ossip Mandelstam las seinem Freund im selben Jahr ein Epigramm vor, in dem er Stalin als »Mörder und Bauernschlächter« bezeichnete. Olga Iwinskaja, Pasternaks Geliebte, erzählt in ihren Erinnerungen, wie es dabei zuging. »Das habe ich nicht gehört, du hast es mir nie vorgelesen«, habe Pasternak geantwortet.
Du weißt doch, daß jetzt sonderbare und schreckliche Dinge passieren. Sie haben angefangen, Leute festzunehmen. Die Wände haben Ohren, vielleicht sogar die Bänke hier auf dem Boulevard.
Kurz darauf wurde Mandelstam auf Befehl des NKWD-Chefs Jagoda verhaftet und zunächst nach Woronesch verbannt. Stalin befahl diesem Henker, den Dichter »aufzubewahren, aber zu isolieren«. Sofort habe Pasternak bei Bucharin zugunsten seines Freundes interveniert. Der wandte sich direkt an Stalin:
Ein erstklassiger Dichter, aber nicht ganz normal. Pasternak ist entsetzt über seine Verhaftung… Die Dichter behalten immer recht, die Geschichte ist auf ihrer Seite.
Bucharins Plädoyer war vergeblich. Bald danach setzten die ersten Moskauer Schauprozesse ein.
Zu Neujahr 1936 erschienen in der Iswestija zwei Gedichte Pasternaks, die von Stalin handelten und in späteren Ausgaben fehlen:
Er lebt, uns fern, in diesen Tagen
in der steinernen Mauern Schoß,
kein Mensch, nur Handeln: seine Taten
sind wie der Erdenball so groß.
Ob das ein Kniefall war? Zwanzig Jahre später schrieb Pasternak an den Rand des Manuskripts:
Ich war nicht immer der, der ich jetzt bin. Noch 1935 glaubte ich, die Epoche der Härte sei abgeschlossen. Als die fürchterlichen Prozesse begannen, zerbrach alles in mir.
Er weigerte sich 1937, Resolutionen zu unterschreiben, die Todesurteile gegen die »Volksfeinde« forderten. Das war lebensgefährlich. Pasternak erwartete, mit seiner Frau verhaftet zu werden, und schrieb einen verzweifelten Brief an Stalin. Der soll, als ihm ein Dossier über den Dichter vorgelegt wurde, das zu einer Anklage wegen imaginärer Spionage geführt hätte, angeordnet haben:
Laßt diesen Hans-Guck-in-die-Luft in Ruhe!
Wieweit es sich bei diesen Berichten um bloße Gerüchte handelt, wird wohl nie mehr genau zu ermitteln sein.
Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion meldete sich Pasternak freiwillig an die Front, wurde aber erst 1943 in den Krieg geschickt, und zwar mit einer »Schriftstellerbrigade«. Das hinderte ihn nicht daran, weitere Gedichte zu schreiben.
Von 1946 bis 1955 arbeitete er an Doktor Schiwago, seinem ersten und einzigen Roman. Die Handlung setzt 1903 ein und endet 1929; nur der Epilog führt bis ins Kriegsjahr 1943. Schiwago ist ein Intellektueller, der mit der Partei hadert und allmählich zum Dissidenten wird. Selbstverständlich durfte das Buch in der Sowjetunion nicht erscheinen. Pasternak übergab das Manuskript einem Kurier, dem er sagte:
Sie sind jetzt zu meiner Hinrichtung eingeladen.
Als es in Mailand dem Verleger Giangiacomo Feltrinelli überbracht wurde, der sofort eine italienische Übersetzung in Auftrag gab, sprach sich das in Windeseile herum. Der Roman erschien bald in zwanzig anderen Sprachen und wurde zu einem lawinenartigen Erfolg. Beim großen Publikum drohte seine Verfilmung sogar Pasternaks Prosa in den Schatten zu stellen. Die russische Erstausgabe des Romans erschien unter konspirativen Umständen in Den Haag beim Wissenschaftsverlag Mouton. Sie war, wie sich herausgestellt hat, von der CIA finanziert.
Dann ereilte ihn 1958 der Nobelpreis. Er nahm ihn zunächst an, mußte ihn aber später ablehnen, weil das Politbüro eine heftige Hetzkampagne gegen ihn inszenierte. »Nicht einmal ein Schwein tut, was Pasternak getan hat. Er hat das Land besudelt, dessen Brot er frißt«, sagte ein eifernder Funktionär vor 14.000 Zuhörern in einem Fußballstadion. Pasternak wandte sich an Nikita Chruschtschow und schwor, daß er Rußland auf keinen Fall verlassen werde. Mit dem Ausschluß aus dem Schriftstellerverband hatte er längst gerechnet. »Sie können mich erschießen, verbannen, tun, was Sie wollen«, schrieb er an den Vorsitzenden.
Ich verzeihe Ihnen schon jetzt. Aber übereilen Sie nichts. Es wird Ihnen kein Glück und keinen Ruhm bringen. Sie wissen, daß Sie mich eines Tages ohnehin rehabilitieren müssen.
Pasternak hat mit seiner Prognose recht behalten. Er wurde 1987 rehabilitiert und postum wieder in den heiligen Schriftstellerverband aufgenommen. Doktor Schiwago konnte daraufhin endlich in der Sowjetunion erscheinen.
Boris Pasternak ist 1960 in Peredelkino am Krebs gestorben. Den Nobelpreis hat Jewgeni, sein Sohn, später stellvertretend für den Vater entgegengenommen.