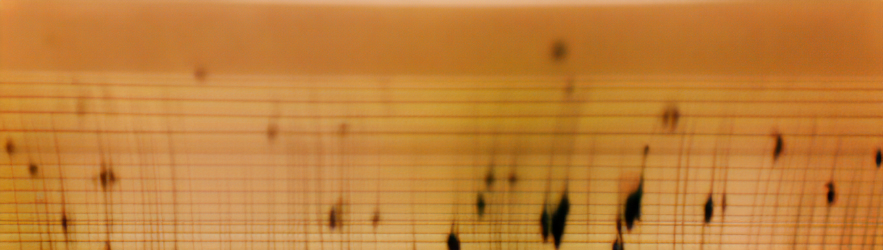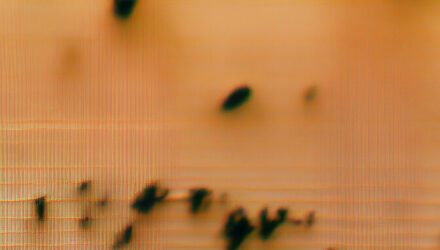Überlebenskünstler Bertolt Brecht
Über B. B. ist schon alles gesagt. Jeder Winkel seines Daseins ist ausgeleuchtet und ausgelegt worden. Er war jemand, der zu bewundern und zu vermeiden war. Ich wußte, daß er immer ein Ausbeuter war und daß er stank. Alle seine Schüler und seine Anbeterinnen hat er plattgedrückt.
Ich mochte manche von seinen Sachen. An der Hauspostille war nicht vorbeizukommen, und Mahagonny war scharf, lustig und böse. Unangenehm waren die meisten Theaterstücke, in denen er den Zeigefinger wie ein Schulmeister hob, im Jasager, im Neinsager und in der berüchtigten Maßnahme von 1930. Man mußte den Haufen, den er hinterließ, entschieden auskämmen. Er hat ja wie Goethe jeden Wisch aufgehoben, vom Schmierzettel bis zur Wäscherechnung, weil er schon als Pennäler wußte, daß er das Zeug zum Klassiker hatte.
Das beste war, mit ihm so umzugehen, wie er es mit anderen hielt: Nur wo etwas Brauchbares zu finden war, galt es ihn auszubeuten. An diese Regel habe ich mich allerdings nicht immer gehalten. In einem Gedichtbuch habe ich ihm nachgeplappert, was er anno 1927 in seinem »Kurzen Bericht über 400 (vierhundert) junge Lyriker« behauptet hat: daß Gedichte Gebrauchsgegenstände seien. Das ist eine Viertelwahrheit von geringer Halbwertszeit.
Aber ansonsten habe ich ihm viel zu verdanken, auch wenn ich mit seinen vielen Talenten nicht konkurrieren konnte. Fabelhaft waren seine Selbstinszenierungen. Er war unerhört intelligent, eine Eigenschaft, die er nicht mit allen Dichtern teilte. Bekanntlich kann man in der Poesie auch ohne sie auskommen und ganz beachtliche Lyrik zustande bringen. Auf die Dauer allerdings ziehe ich die gescheiteren Mitbrüder in Apollo vor. Das ist nicht nur eine Frage der Poetik. Brecht war ein weitblickender politischer Stratege, der alle Wendungen der Geschichte wie ein Haruspex aus ihren Eingeweiden las. Die Diktaturen in Italien, in Deutschland und in Spanien hat er kommen sehen und ihre katastrophalen Folgen sofort verstanden.
Weniger einsichtig war er, was die Parteiherrschaft in der Sowjetunion angeht. 1930 verstieg er sich zu ihrem Lob. In seinem tückischen Lehrstück Die Maßnahme singt ein »Kontrollchor«:
Der einzelne kann vernichtet werden,
Aber die Partei kann nicht vernichtet werden.
Denn sie ist der Vortrupp der Massen
Und führt ihren Kampf
Mit den Methoden der Klassiker, welche geschöpft sind
Aus der Kenntnis der Wirklichkeit.
Das sind nicht nur ziemlich schlechte Verse. Auch politisch verraten sie eine ganz verkehrte Einschätzung. Wie es seine Gewohnheit war, hat Brecht auch in diesem Stück den einen oder anderen »dialektischen« Vorbehalt versteckt. Er verfügte über ein ganzes Arsenal von solchen Manövern. Schon 1922 schrieb er in sein Tagebuch:
Das Gesündeste ist doch einfach: Lavieren.
Zwar entwickelte er sich in der Weimarer Republik zu einem gelernten Kommunisten, doch vermied er es sorgfältig, in die KPD einzutreten.
1927 war die herrliche Sammlung Bertolt Brechts Hauspostille erschienen. Schon damals zeigte sich, wie er vorging. Er arbeitete am liebsten mit anderen zusammen, achtete aber darauf, daß er stets die Zentralfigur des Teams blieb. Er war in der Lage, von Lebenden und von Toten zu klauen.
Sein eigenes Copyright jedoch wußte er mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Seine vielen Mitarbeiterinnen und Geliebten, wie Ruth Berlau, Elisabeth Hauptmann und Margarete Steffin, hatten wenig zu lachen.
Im Mai 1933 wurden seine Bücher dem Feuer übergeben und seine Werke verboten. Er verließ Deutschland rechtzeitig, genau einen Tag nach dem Reichstagsbrand. Seine Flucht führte über Prag, Wien und Zürich nach Paris. Kurz darauf erwarb er ein Haus in Dänemark. Als die Deutschen das Land besetzten, ging er nach Finnland, das damals noch neutral war.
Obschon er an Stalins Terror, seinen »Säuberungen« und Schauprozessen, öffentlich nichts auszusetzen hatte, gelang es ihm im Mai 1941, sich ein Einreisevisum in die Vereinigten Staaten zu verschaffen und mit seiner Familie über Moskau nach Kalifornien zu gelangen. Für seine Freundin und Mitarbeiterin Carola Neher, die in die Sowjetunion emigriert war, konnte er nichts tun. Sie war als »trotzkistische Agentin« verhaftet und zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt worden. 1942 ist sie im Gulag gestorben.
In Hollywood, wo er erfolglos blieb, gefiel es Brecht nicht. Als die USA in den Krieg eintraten, galt er als enemy alien und wurde vom FBI überwacht. 1947 sollte er vor einem Kongreßausschuß wegen »unamerikanischer Umtriebe« Rede und Antwort stehen. Seine ironischen Antworten machten aus der Anhörung eine bravouröse Kabarett-Nummer.
Am nächsten Tag kehrte Brecht nach Europa zurück, um seine Theaterarbeit wiederaufzunehmen. Die Einreise nach Westdeutschland wurde ihm verweigert; deshalb ließ er sich in der Schweiz nieder. 1948 wurde er nach Ost-Berlin eingeladen. Dort nahmen nicht nur die Künstler, sondern auch die Parteifunktionäre ihn gerne auf.
Nicht zufrieden war Brecht mit seinem Paß. Schon 1935 war ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt worden. In seinen Flüchtlingsgesprächen, die größtenteils 1940/41 entstanden sind, sagte er hellsichtig voraus:
Der Paß muß ein Paß sein, damit sie einen in das Land hereinlassen… Der Paß ist der edelste Teil von einem Menschen.
Dieses Problem löste Brecht 1950 während eines Auftritts bei den Salzburger Festspielen. Er erreichte, daß ihm die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen wurde. Natürlich hatte er nie die Absicht, die DDR zu verlassen. Ein ausländischer Paß hatte eben auch im sogenannten Ostblock seine Vorzüge. Als die Partei den »Formalismus« zur gefährlichen Abweichung erklärte, agierte Brecht umsichtig und ließ sich auf keine theoretische Auseinandersetzung ein. 1954 konnte er endlich sein Theater am Schiffbauerdamm eröffnen. Als es am 17. Juni 1953 in der DDR zu Massenprotesten der Arbeiter kam, ärgerte er sich. Noch am selben Tag drückte er in einem Brief an Walter Ulbricht seine Verbundenheit mit der Partei aus. Weitere Solidaritätsadressen schickte er an das Außenministerium in Moskau und beteuerte seine »unverbrüchliche Freundschaft zur Sowjetunion«. Leider hatte die Zensur seinen Brief gekürzt. Brecht war wütend. Ein paar Monate lang trug er eine Kopie des vollständigen Textes mit sich herum und zeigte sie seinen Freunden. Er konnte beweisen, daß er sich von der Haltung der Parteioberen deutlich distanziert hatte.
Das konnte sein Publikum aber erst lesen, als das Kind längst in den Brunnen gefallen war, nämlich in dem berühmten Gedicht »Die Lösung« in den Buckower Elegien. Die Bühnen im Westen setzten seine Stücke ab, und es dauerte lange, bis dieser Boykott aufgehoben wurde.
Es ging ihm schlecht, und er wurde ernsthaft krank. Er starb im August 1956 an »Herzversagen«. Die Verse, die er auf seinem Grab haben wollte, sind dort nicht zu lesen. Aber daß er sich alle Reden bei der Beerdigung in seinem Testament verbat, daran haben sich alle gehalten.
Erst in seinen letzten Tagen, den Tod vor Augen, hat er mit Stalin, dem »verdienten Mörder des Volkes«, abgerechnet.
Für den Nobelpreis war Brecht ungeeignet. Überhaupt kamen, obwohl er weltberühmt war, nur wenige Auszeichnungen auf ihn herunter: der Kleist-Preis, der Nationalpreis der DDR I. Klasse und der Stalin-Preis für Frieden und internationale Verständigung, der ihm allen Ernstes im Kreml überreicht worden ist.
Er ist immer beizeiten abgehauen. Ein Gerücht besagt, daß er nicht nur einen österreichischen Paß besaß, sondern auch ein Konto und einen Banksafe in der Schweiz, in dem Dokumente lagerten, deren Publikation für die kommunistischen Parteien nicht zuträglich gewesen wären. Wer ihm aus all diesen Vorkehrungen einen Vorwurf machen wollte, dem fehlt es an historischer Phantasie.