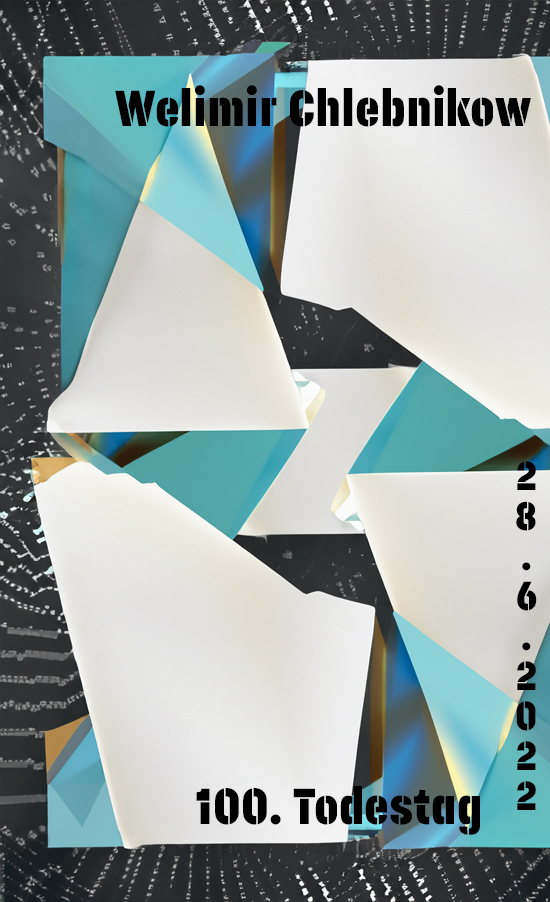
Schamanismus der Sprache
– Zu Chlebnikovs Neu-Entdeckung. –
I
Wir schreiben das Jahr 1910. Der Zar Nikolaus II. besucht Kaiser Wilhelm in Potsdam. Kandinskij malt sein erstes abstraktes Bild. Tolstoj stirbt auf der Flucht aus Jasnaja Poljana auf einer einsamen Bahnstation. Ivan Bunin wird in die Russische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Aus der Provinz kommt ein junger Bauernsohn in die Hauptstadt, schockt und entzückt mit seinen Gedichten die dort herrschende Literatur-Clique: Sergej Jessenin, der »russische Rimbaud«. In der Kellerkneipe Zum streunenden Hund treffen sich Schriftsteller und Schauspieler, Künstler und Kritiker, und entwerfen ihre programmatischen Manifeste, die Imaginisten wie die Akmeisten, am lautesten eine Gruppe von Rebellen, die sich später nach einer italienischen Bewegung Die Futuristen nennen werden. An ihrer Spitze ein 25jähriger Student aus Astrachan, Victor Vladimirovič Chlebnikov, der mit diesem Gedicht die Öffentlichkeit schockiert:
BESCHWÖRUNG DURCH LACHEN
Oh, entlacht, Lacherer.
Oh, erlacht, Lacherer.
Daß sie Gelächter lachen, daß sie lachantern lachal.
Oh erlacht lächeral.
Oh überlachaler Entlächtrichte – Gelächter lächlericher Lacherer.
Lacherein, lacherein,
lächle, lächerle, Lacheli, Lacheli,
Lachelanten, Lachelanten,
Oh entlacht, Lacherer.
Oh erlacht, Lacherer.
(Deutsch von Rolf Fieguth)
Zwei Jahre später gibt Chlebnikov, der sich jetzt mit Vornamen Velimir (manchmal auch: Velimir I.) nennt, zusammen mit Alexander Kručonych und Vladimir Majakovskij jenen berühmten futuristischen Almanach heraus, der radikal mit der herrschenden Ästhetik aufräumt, alle Regeln der Poesie und alle Tradition verwirft, die Klassiker ächtet und nichts anderes sein will (und so heißt das Buch auch) als: Eine Ohrfeige dem öffentlichen Geschmack.
Die Schulen und Richtungen wechselten im Petersburg des Vorkriegs sehr rasch, aber keine Gruppe war so radikal im Hinwegfegen des Alten, keine aber auch so kühn in der Erneuerung. Den Futuristen ging es nicht mehr um formale Prinzipien, das damals Revolutionäre ihrer Absichten bestand darin, die Sprache als Mitteilung zu entthronen, die Worte aus ihrem semantischen und grammatikalischen Gefängnis zu befreien:
Wir haben aufgehört, Wortbau und Wortaussprache nach grammatischen Regeln zu betrachten, wir haben begonnen, in den Buchstaben nur Wegweiser für Wörter zu sehen. Wir haben die Syntax erschüttert.
Wir haben begonnen, den Wörtern Inhalt nach ihrer graphischen und phonetischen Charakteristik zu geben.
Vokale verstehen wir als Zeit und Raum (der Charakter der Richtung).
Konsonanten – sind Farbe, Klang, Geruch…
Wir halten das Wort für den Schöpfer des Mythos, das Wort gebiert, sterbend, den Mythos und umgekehrt.
Wir stehen in der Gewalt neuer Themen: Unnötigkeit, Sinnlosigkeit, das Geheimnis der eigenen Nichtigkeit – sind von uns besungen worden.
Wir verachten den Ruhm; uns sind Sinne bekannt, die vor uns noch nicht gelebt haben.
Wir sind die Menschen des neuen Lebens.
Man sieht, sie unterschieden sich deutlich von den italienischen Futuristen, machten vor allem nicht deren Anti-Intellektualität mit; als Marinetti zu einer Vortragsreise nach Rußland kam, war es Chlebnikov, der ihn am heftigsten attackierte. Nicht um die Rivalität der Gruppen ging es, Chlebnikov warf den Italienern vor, daß sie nur die Oberfläche der Sprache verwischt hatten und zu einer tiefgreifenden Veränderung des Wortsystems nicht fähig wären. Er selbst arbeitete mit seinem Freund Kručonych an einem neuen verbalen Verständigungskodex, ZAUM genannt (Zaum – jenseits der Logik), und träumte von einer poetischen Weltsprache, er suchte nach einer »Lautschrift des Frühings«, dem »Alphabet des Geistes« und dem »Wörterbuch der Sternensprache«.
Ein Esperanto der Poesie, bei dem die Methodik interessanter war als das Ergebnis. Das W sollte da z.B. die Wellenbewegung, das Kreisen ausdrücken, also ein Synonym für Wind, Wirbelsturm, Woge, Wendeltreppe etc. Das H ein Schutz also für Hütte, Häuschen, Hoffnung, Hort, Heilung, das T für den Blicken Verborgenes, also für Trübsal, Trug, Tunnel, Tod, Trauer etc.
Es ist verständlich, daß ihm die meisten seiner futuristischen Genossen auf diesem Weg nicht mehr folgten; es gab Spaltungen, es gab den Ego-, den Kubo-Futurismus – für Chlebnikov waren das alles Durchgänge. In einem ständigen Fortschreiten hat er den in den ersten Manifesten schon vorgezeichneten Weg konsequent und radikal fortgesetzt wie keiner der andern, und er hat zur Euphonik gefunden (einer Art Laut-Poesie), die ihn eine Zeitlang sogar populär gemacht hat.
GEWITTER IM MONAT AU
Pupupop! Das ist der Donner.
Gam gra gra rapp rapp.
Pi-pipisi. Das ist er.
Baj gsogsisi. Das bist du.
Goga, gago – das erhabne Donnergrollen.
Gago, goga!
Ssch. Ssch.
Mn! Mn! Mn!
Me – momomuna. Alles blaut…
In dieser Methodik hat er einige seiner originellsten Texte geschrieben, und so wurde er rasch unter die Lautmaler subsummiert: dieses Etikett hat er am längsten tragen müssen. Auch dann, als er schon längst weiter ging: er entwarf eine Theorie der Wurzelflexion, die für alle Sprachen gelten sollte; suchte nach Sprachstrukturen, die jenseits der syntaktisch-grammatischen Oberfläche eigene Gesetzmäßigkeiten anzeigten; beschäftigte sich mit der »Welt der Ziffern«, die er in einer ebenso eigenlogischen wie phantastisch-abstrusen Weise in eine höhere poetische Kabbalistik formierte; entdeckte und erforschte die »Tafeln des Schicksals«, aus denen er mit Hilfe eines ausgeklügelten mathematischen Systems eine Methodik der Zukunftsforschung entwickelte.
Das sind staunenswerte, überraschende, manchmal befremdliche Gebilde, die ihre wissenschaftliche Stimmigkeit nur zu gern einer poetischen Stimmigkeit opfern; nur der Weg sollte der Richtige sein, der Weg zu einer universalen Poesie.
II
Man sagt, Gedichte müßten verständlich sein. So… ein Aushängeschild auf der Straße, auf dem in klarer und einfacher Sprache geschrieben steht: hier wird das und das verkauft. Aber ein Aushängeschild ist noch kein Gedicht. Aber es ist verständlich. Auf der anderen Seite, warum sind die Zaubersprüche und Beschwörungsformeln der magischen Sprache, die heilige Sprache des Heidentums, diese ›schagadam, magadam, wygadam, pitz, patz, patzu‹ – warum sind diese Reihe gesetzter Silben, in denen der Verstand sich nicht klarwerden kann und die in der Volkssprache gleichsam als ›Zaum-Sprache‹ erscheinen? Dennoch: diesen unverständlichen Wörtern wird die größte Macht über den Menschen zugeschrieben, der Zauber der Wahrsagerei, der direkte Einfluß auf das Schicksal des Menschen. Ihnen wird die Macht zugeschrieben, in Gut und Böse zu lenken und das Herz der Zarten zu leiten. Die Gebete vieler Völker sind in einer Sprache geschrieben, die den Betenden unverständlich sind. Versteht denn der Inder die Veden? Die kirchenslavische Sprache ist dem Russen unverständlich. Die lateinische – dem Polen und Tschechen. Aber ein lateinisch geschriebenes Gebet wirkt nicht minder stark als ein Aushängeschild. Daher will die magische Rede der Zaubersprüche und Beschwörungsformeln nicht den Alltagsverstand zu ihrem Richter haben.
Das Wort also als Beschwörung, als Zauberspruch, als Schamanismus. Irgendwo steckt das in jedem Gedicht. Gehn wir ein paar Stufen tiefer, machen wir’s nicht so mystisch. Das wichtigere Wort ist: den Alltagsverstand ausschalten. Das Besondere der Poesie: daß man sie in einer Sprache schreibt, die sich radikal von der Gebrauchssprache unterscheidet. Wie das Bild von der Fotografie. (Das hatten jedenfalls die italienischen Futuristen beabsichtigt.) Und Chlebnikov hatte mit seinen Versuchen Ähnliches im Sinn, als er im ersten Manifest schrieb:
Wir wollen, daß das Wort kühn und tapfer der Malerei folgt.
Er war kein Fanatiker. Er war auch kein starrer Methodiker. Einmal ein Verfahren benutzt, ausgeschöpft, entdeckte er ein neues.
Gedichte können verständlich sein, sie können unverständlich sein, aber sie müssen gut sein, sie müssen echt sein. (1919)
Das Wort als Sinn-Aussage kam ihm immer dort zupaß, wo er es als notwendig empfand, und in seinen poetischen Texten hat er das Semantische und das Euphonische wie eine Collage benutzt. Die Euphonik freilich her, wie Roman Jakobson mit Recht bemerkt, nicht als reine Lautmalerei verstanden, sondern »als Phoneme, d.h. akustische Vorstellungen, die geeignet sind, sich mit Sinn-Vorstellungen zu assoziieren«. Das euphonische Wort als sinn-überschreitende Rede.
In Zangezi, dem letzten vor seinem Tod geschriebenen Gedicht – d.h. es ist eine Art Gesamtkunstwerk mit Lyrik, Szene, Lautornament, Wörterbuch, Lautschrift, Formeln, Farbe und Klang – ist dieses Prinzip wohl am reinsten und überzeugendsten ausgedrückt:
ZANGEZI in 20 Wortebenen (drei Ausschnitte, die ungefähr die Tendenz zeigen): Berge. Über einer Waldwiese erhebt sich eine rauhe steile Felsklippe, ähnlich einer Eisennadel unter einem Vergrößerungsglas. Wie ein an die Wand gelehnter Stock steht sie neben den lotrechten Steinen der mit Nadelwald überwachsenen Steinschichten. Mit der Grundsteinart verbindet sie ein Brückenplätzchen, das ihr wie der Strohhut eines Bergrutschs auf den Kopf gefallen ist. Dieser Platz ist Zangezis Lieblingsplatz. Hier ist er jeden Morgen und liest seine Lieder.
Von hier aus hält er seine Predigten an die Menschen oder den Wald. Eine hohe Tanne, ungestüm mit den blauen Wellen ihrer Nadeln wallend, bedeckt einen Teil der Klippe, es scheint als sei sie eine Vertraute und wache über seine Ruhe…
Die Götter. Ebene zwei.
Eros: Mara-roma / biba-bull! / Uks, kuks, el! / Rededidi dididi! Piri-peppi, pa-pa-pi! / Tschogi guna, geni-gan! Al, el, il! / Al el ili! / Eck, ack, uck! / Gamtsch, gemtsch, io! / Rpi! Rpi!
Antwort der Götter: Na-no-na! / Etschi, utschi, otschi! / Kesi, nesi, dsigaga! / Nisarisi osiri. / Memaura simoro. / Pips! / Masatschitschi-tschimoro! Pljan!
Die Menschen. Ebene drei.
Leute: Oh, Mutter Gottes!
1. Passant: Er ist also hier. Dieser Trottel aus dem Wald?
2. Passant: Ja.
1. Passant: Was macht er gerade?
2. Passant: Er liest, er redet, er atmet, er sieht, er hört, er geht einher, morgens betet er.
1. Passant: Zu wem?
2. Passant: Das versteht sowieso kein Mensch! Zu den Blumen? den Käfern? den Kröten des Waldes?… Was ist das? Ein Fetzen der Handschrift von Zangezi… Eine schöne Handschrift!
1. Passant: Lies doch laut!
2. Passant: »Tafeln des Schicksals! Wie die Schriftzeichen der schwarzen Nächte steche ich euch aus, Tafeln des Schicksals! Drei Zahlen! Wie ich, als ich jung war, wie ich, als ich alt war, wie ich in den mittleren Jahren, gemeinsam kommt ihr die staubige Straße daher. 105 + 104 + 115 = 742 Jahre und 34 Tage. Leset, Augen, das Gesetz vom Untergang der Staaten. Hier die Gleichung: X = k + n (105 + 104 + 115) – (102-(2-1)) 11 Tage.
Roman Jakobson, Haupt der Formalisten und heute Lehrer in Harvard, hat schon 1921 in einem frühen Aufsatz Chlebnikov gewürdigt („Die neueste russische Poesie. Erster Entwurf: Victor Chlebnikov«), ein Aufsatz nicht nur über einen jungen Dichter, sondern auch über die kritischen Essentials der formalistischen Methode, die in der Linguistik immer mehr an Einfluß gewinnt. Die Entdeckung Chlebnikovs kommt also im richtigen Moment. Das Interesse dafür ist auch in dieser Richtung zu suchen. Waren doch die Futuristen wie die Kritiker der formalistischen Schule (Opojaz) zum Teil befreundet, lebten sie in ständigem Gedankenaustausch – daher kommt es, daß sich hier Theorie und Text wie selten in einer künstlerischen Bewegung decken.
Mit Chlebnikov wird nicht ein Lautdichter entdeckt – das haben wir ähnlich (und triftiger, weil in deutscher Sprache gedacht und geschrieben) bei Schwitters und Stramm und Arp –, sondern Methode, Gesetzmäßigkeit und Struktur dieser Poesie und ihrer Poetologie sind es, die auf weite Strecken unser Fasziniertsein ausmachen: die Besessenheit und Systematik, mit der das alles gemacht wurde, die Summe der Erfindungen und auch die virtuose Beherrschung der einmal eroberten Mittel. »In allen Sachen von Chlebnikov fällt seine ungeheure Meisterschaft ins Auge«, schrieb dazu Majakowskij. Ob nun ZAUM ein historisches Petrefakt geblieben ist, die Zahlen-Kabbala eher verblüfft als einleuchtet, die Zukunftsdeutung ins Fragwürdige abgleitet und der Versuch einer neuen »transmentalen« Sprache nur halbwegs geglückt ist, darauf kann es nicht ankommen – Chlebnikov hat als erster die Methode, das Verfahren als das eigentliche Ergebnis seiner Kunst angesehen und damit sich den immer häufiger wechselnden Kunstdefinitionen entzogen. (Ich kenne nur einen, der Ähnliches heute in der Musik versucht hat, das ist Stockhausen.)
Hinzu kommt (vielleicht als ein zu privates, persönliches Moment) die Bewunderung für einen Mann, der in Krieg und Revolution, in Bürgerkriegs- wirren und zunehmender Vereisung seiner (politischen) Umwelt unbeirrt und konsequent seinen Weg gegangen ist, bis zu seinem allzu frühen Tod im Jahre 1922, mit dem die junge sowjetische Literatur sicher ihren anregendsten, originellsten und wohl auch unbequemsten Autor verlor.
III
Lange war Chlebnikov nicht mehr als ein Name im Katalog der vorrevolutionären Avantgarde, manchen galt er als ein Geheimtip; sein Name tauchte im Zusammenhang mit den Manifesten der Futuristen auf, wobei von der offiziellen Geschichtsschreibung sein Verdienst zugunsten Majakovskijs zurückgedrängt wurde. Im Cabaret Voltaire sollen einige »Phoneme« von Chlebnikov 1916 vorgetragen worden sein. In Frankreich hatten die Lettristen um Isidore Issue nach dem Krieg einige seiner Lautgedichte übersetzt und ihn als ihren Stammvater reklamiert; hier und da sah man auch bei uns ein paar konventionelle (oder nur konventionell übersetzte?) Verse abgedruckt. Durch die zweibändige, kürzlich bei Rowohlt erschienene Ausgabe von Peter Urban, die wohl umfangreichste und sorgfältigste der Chlebnikov-Schriften überhaupt in einer anderen Sprache, werden wir nicht nur über ein gewichtiges Kapitel russischer Literatur- und Geistesgeschichte informiert, das vorher – wenn überhaupt – nur verfälscht zu unserer Kenntnis kam; dem deutschen Sprachbereich wurde ein Autor gewonnen, dem von der poetischen Qualität her wohl nicht geringere Bedeutung zukommt als Mandelstam oder Majakovskij, und der in der Geschichte der Spracherneuerungen neben Cummings, Schwitters oder Paul van Ostaijen genannt werden muß (nicht aber neben Ezra Pound!).
Warum er uns so spät erschlossen wird, hat zahlreiche Gründe. Die Geschichte der Edition eines Chlebnikov-Werkes ist ja auch ein Stück politischer Geschichte. Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat er alles, was er geschrieben hat, entweder in Almanachen oder im Selbstverlag gedruckt. Es müssen goldene Zeiten gewesen sein. In einem Brief vom 23. April 1912 schreibt er an seine ältere Schwester:
Ich gebe [mein neues] Buch im Selbstverlag heraus. (Für 15 Rubel.) Überhaupt kann man hier für rund zehn Rubel ein Buch herausgeben. Und ich lasse im Sommer noch ein Buch in Gottes Welt hinaus…
Im Kriege wurde es schwieriger und nach der Revolution übte die Partei mit den Papierzuteilungen eine Art Zensur aus. Trotzdem hat es immer wieder Versuche gegeben, das niemals so recht geordnete, konvolutische Werk Chlebnikovs zu edieren, zeitweilig erschienen zur gleichen Zeit zwei Ausgaben, eine davon allerdings nur in 150 Exemplaren. Das hörte in den dreißiger Jahren auf, das Verbot der Opojaz-Gruppe, der formalistischen Schule, war zugleich das Verbot der öffentlichen Rezeption des Dichters. Einzelbände mit ausgewählten Texten, die später herauskamen, klammerten den Futuristen und Sprach-Experimentator aus, sie wurden in der Stalin-Ära gemacht, um wenigstens seinen Namen nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen. Die vollständigste russische Ausgabe von Chlebnikov ist jetzt in einem deutschen Verlag erschienen, bei Fink in München. Auf diese hauptsächlich stützt sich Urbans zweibändige Auswahl von ca. 1.100 Seiten mit Poesie, Prosa, Theaterstücken (frühen Beispielen des absurden Theaters etwa in Frau Lenin), theoretischen Schriften und Briefen.
Die Ausgabe spart auch Nebensächliches, Entlegenes und Abseitiges nicht aus. Das gibt uns Einsicht in das Denken eines Poeten, der auf der einen Seite linguistische Probleme wissenschaftlich erörterte, auf der anderen ernsthaft Tabellen mit Jahreszahlen aufstellte und mit einem Multiplikator magischer Zahlen eine Art Handlesekunst der Zukunft betrieb. Die Liste seiner »Wortschöpfungen«, die seitenweise vorgelegt werden, haben immerhin etwas von Amüsement bis zum Kalauer. Ein Autor heißt da z.B. Werkner, Wortner oder auch Worterer. Die Komödie ist eine Lache, eine Trauer-raus. Die Tragödie eine Qualsal oder ein Schicksalszank oder Qualzeug. Die Farce ein Langweiltod. Die Oper eine Stimmnis oder eine Brüllnis. Der Chor eine Singenei. Der Regisseur ein Willrich, ein Wollter oder Einrichtrich. Der Kritiker ein Quäkel-Mäkel. Manche hübsche Pointe kommt hier wohl auf das Konto blödelnder Übersetzung.
Wir sehen also heute auch die Sackgassen, die Vergeblichkeiten, die Irrtümer – auch den höheren Quatsch. Das kann beileibe Chlebnikovs Leistung und Bedeutung nicht schmälern! Es darf nur unser Urteil nicht außer Kraft setzen. So sehr zum Beispiel der reiche und sorgfältige Anmerkungsapparat der deutschen Ausgabe begeistern muß, so sehr ist die reine Hagiographie im Nachwort zu bedauern. Über das Biografische erfährt man zu wenig, und gerade die letzten Jahre, seine Reisen, seine Kontakte (oder auch Zerwürfnisse) mit den alten Freunden aus der futuristischen Bewegung, seine zunehmende Vereinsamung, sein Verhältnis zur neuen Sowjetmacht, könnten wichtige Aufschlüsse gerade über seine letzten Arbeiten liefern. Von Majakovskij erfahren wir, daß er »selten überhaupt eigene Hosen hatte, geschweige denn etwas zu essen«: so hätte man über seine privaten Umstände auch etwas Näheres gewußt.
Und die Idee, bestimmte Gedichte in drei, vier oder gar fünf Versionen verschiedener Autoren vorzulegen, ist nur auf den ersten Blick bestechend. Gerade hier, wo fast nur Autoren der deutschsprachigen »konkreten« Schule am Werkeln waren, führt das zu einem Festival des Lettrismus, in dem der originäre Text manchmal entschwindet. Zum Glück haben Rosemarie Ziegler und der Herausgeber Peter Urban selbst, die beide aus dem Russischen übersetzen, einen großen Teil verdeutscht, vor allem die theoretischen Schriften; aber auch bei den Gedichten ziehe ich deren Fassungen vor, die auf manch brillanten, aber oft genug verfälschenden Einfall verzichten.
Chlebnikov ist jetzt UNSER – zu diesem Urteil muß man kommen, wenn man die Rezensionen der letzten Wochen hierzulande verfolgt hat. Es gibt eine Chlebnikov-Euphorie, hauptsächlich veranstaltet von den »konkreten« Autoren und/oder ihren feuilletonistischen Satrapen. Wie die Surrealisten sich einst auf Lautréamont stürzten und ihn als ihren geistigen Vater ausriefen, so legitimieren die »Konkretisten« jetzt mit dem Russen ihre junge Tradition. Und sie haben recht damit. Wenn auch Chlebnikov beileibe nicht jenes furiose, himmelstürmende Genie war wie Lautréamont – der Konkretismus hat ja auch längst nicht die Bedeutung wie einst der Surrealismus. Eine nicht nur jubelnde und heiligsprechende, sondern eher analysierende oder auch nur ausdeutende kritische Rezeption wäre freilich mehr geeignet, diesem immer noch schwierigen Werk über den Tag hinaus Resonanz zu verschaffen – und die Freude über die Rückkehr des verlorenen Vaters sollte uns nicht vergessen machen, daß die Moderne zahlreiche Ziehväter hat.
IV
Wir schreiben das Jahr 1922. Der Bürgerkrieg ist zu Ende. Die Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken wird gegründet; die neue Hauptstadt heißt Moskau. Deutschland erkennt die SU an. Stalin wird Generalsekretär der Partei. Alle politischen Oppositionsgruppen im Land werden verboten.
Chlebnikov kehrt nach Moskau zurück. »Er war zwei Jahre unterwegs, er machte mit unserer Armee alle Rückzüge und Vormärsche in Persien mit, kriegte einen Typhus nach dem andern. Diesen Winter kam er zurück, im Waggon für Epileptiker, überanstrengt und abgerissen, in einem Krankenkittel«, schreibt Majokovskij. Er bereitet die Ausgabe von Zangezi vor; der Maler Vladimir Tatlin führt Zangezi am 9. Mai im Moskauer Museum für Bildende Künste auf, als »Vorstellung + Vortrag + Ausstellung von Materialkonstruktionen«. Im Sommer geht Chlebnikov aufs Land. Er stürzt aus Schwäche, kommt ins Krankenhaus; er stirbt in Santolovo im Gouvernement Novgorod, 37jährig. In seinem Nachruf nannte ihn Majakovskij »einen Kolumbus neuer poetischer Kontinente, die jetzt von uns besiedelt und urbar gemacht werden.«
Horst Bienek, Merkur, Heft 293, September 1972










