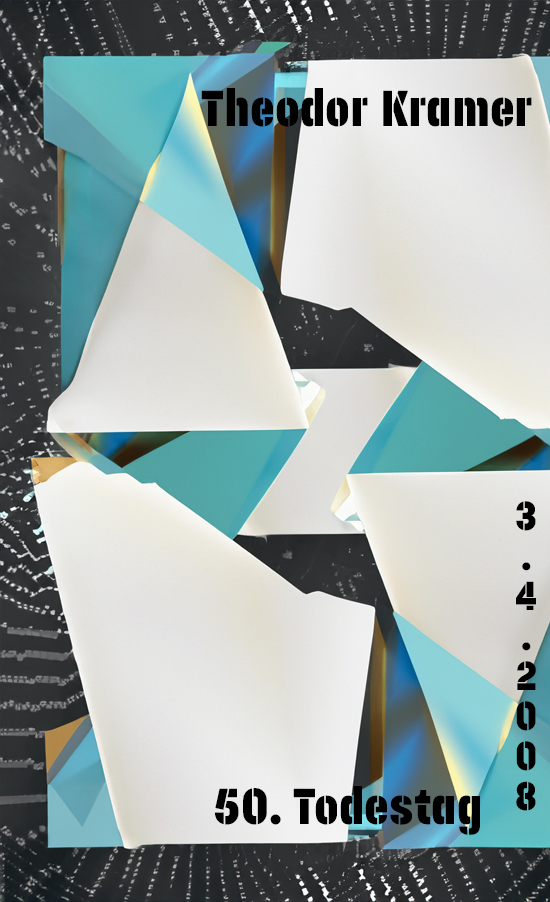
Hieb auf den Kopf, Griff ans Geschlecht
– Sinnlichkeit, Melancholie und die Poesie des Plebejischen. Zum 50. Todestag des großen Lyrikers Theodor Kramer. –
Zu Fronleichnam 1939 war Theodor Kramer noch in Wien. »Wenige waren es, die Stellung nahmen / unterm Himmel, um zur Stadt zu gehen«, gleichwohl zog man am Straßenrand den Hut:
Manche kannten nur vom Hörensagen
noch den Umgang; doch dem baren Haar
tat es wohl, daß selbst in diesen Tagen
irgend etwas manchen heilig war.
Dieses Gedicht des unverdrossenen Patrioten hat Marlene Streeruwitz bei einer Umfrage der Zeitung Politiken 2004 als »Typisches Gedicht« für ihr Österreich genannt – ein Indiz dafür, dass Kramer, der mit seiner Emigration nach England im Sommer ’39 dem kollektiven Gedächtnis nach und nach abhanden gekommen war, es inzwischen zu späten Klassiker-Ehren gebracht hat. In den Schullesebüchern war er freilich längst beispielhaft vertreten, mit zwei Gedichten, die die schleichende Verengung des persönlichen Spielraumes der Verfolgten bis hin zur Bedrohung des Lebens in der angeschlossenen Ostmark unnachahmlich schlicht vorführen: »Wer läutet draußen an der Tür« und »Die Wahrheit ist, man hat mir nichts getan«:
Ich fahr wie früher mit der Straßenbahn
und gehe unbehelligt durch die Gassen;
ich weiß bloß nicht, ob sie mich gehen lassen.
In diesem Psychogramm der Angst spricht Kramer von sich selbst, wenn er »ich« sagt, eine weitverbreitete lyrische Sitte, für ihn jedoch ein Luxus, den er sich nur in Zeiten größter Not – er unternahm 1938 einen Selbstmordversuch – leisten zu dürfen glaubte.
Kramers Domäne war das Rollengedicht, er sprach »Für die, die ohne Stimme sind«. Schon in seinem ersten Gedichtband Die Gaunerzinke (1929), der ihm den Durchbruch bescherte, schlüpfte er so perfekt in die Haut eines Taglöhners, Zimmermalers, Steinbrechers, Bäckerbuben oder Vagabunden, dass Interpreten ihm derlei Berufe biografisch andichteten. Tatsächlich wurde Kramer, 1897 in Niederhollabrunn im Weinviertel als Sohn des Gemeindearztes geboren, im Krieg verwundet, studierte vier Semester Germanistik, versuchte sich im Buchhandel und dann, erfolgreich, als freier Schriftsteller. Um 1930 war er berühmt.
Die Gaunerzinke, deren gereimte Strophen heute den Hautgout des Herkömmlichen haben, erschien den Zeitgenossen aufregend neu: Da war einer, der sich vom (eigenen) überhitzten Spätexpressionismus abwandte und »mit verstaubten Stiefeln, kotbespritzten Hosen in die gute Stube der Poesie« tappte (Carl Zuckmayer). Kramers empathischer Realismus, seine Parteinahme für die Menschen am Rand brachte eine Art »Neue Sachlichkeit« mit Seele hervor – und mit ganz eigener Bildgebung.
Kramer wollte Gedichte schreiben, »die wie ein Rasiermesser aus Solinger Stahl mit einem einzigen Schnitt die Gurgel durchschneiden. Ein Hieb auf den Kopf, ein Griff ans Geschlecht, ein Tritt in den Hintern.« Er wollte das Themenfeld des Lyrischen erweitern, »die ganze Breitseite des Lebens« darstellen, was ihm spätestens mit dem Band Mit der Ziehharmonika (1936) auch gelang. Kramers anarchische Rebellen provozierten die Rechten, seine suggestiven Landschafts- und Bauerngedichte gefielen ihnen; den Austromarxisten war wiederum seine unideologisch nüchterne Weltkriegslyrik ein rotes Tuch. Nicht nur als früher Chronist der Umweltzerstörung misstraute Kramer dem Fortschritt. Als Jude ohne Religion, als Heimatdichter ohne Blut-und-Boden-Komplex, als Sozialist ohne Eignung zur Propaganda saß Kramer schon in der Ersten Republik zwischen allen Stühlen.
In England, wo er als Bibliothekar sein Leben fristete, wurde er nicht heimisch. Einen Band mit dem allzu aufrichtigen Titel Lob der Verzweiflung wollte im Nachkriegsösterreich keiner drucken. Erst 1957 kehrte Theodor Kramer als kranker Mann nach Wien zurück, wo er ein halbes Jahr später starb. Sein Erbe: 12.000 Gedichte. Eine Welt, in der der »schwarze Wein« gedeiht: Sinnlichkeit, Melancholie und die Poesie des Plebejischen.
Daniela Strigl, Der Standard, 29./30.03.2008
Gedenktage
Zum 25. Todestag des Autors:
Zum 50. Todestag des Autors:
Günther Doliwa: Gewaltig ist das Leben
literaturkritik.de, April 2008
Daniela Strigl: Hieb auf den Kopf, Griff ans Geschlecht
Der Standart, 29./30.3.2008
Cornelius Hell: Für die, die ohne Stimme sind
Die Furche, 27.3.2008











