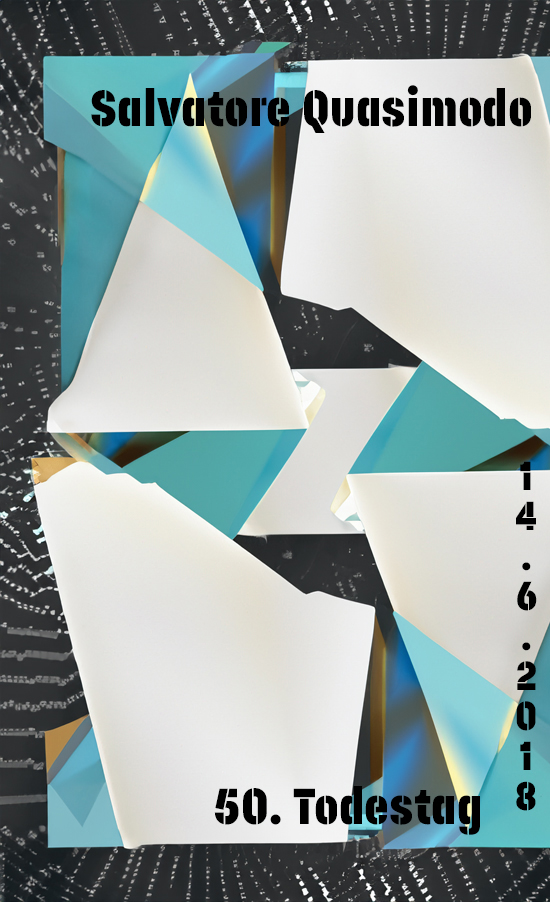
Still ist die alte Stimme
– »Der Politiker will, dass der Mensch mutig sterbe, der Dichter dagegen, dass der Mensch mutig lebe, womit der Dichter zum verschworenen Feind jeder etablierten Ordnung wird.« Diese Worte sprach der italienische Dichter Salvatore Quasimodo in seiner Dankesrede zur Nobelpreisverleihung 1959. Ein Jahr, nachdem Boris Pasternak den gleichen Preis zugesprochen bekam, ihn aber auf Druck der sowjetischen Regierung ablehnen musste. Salvatore Quasimodo – ein zu unrecht fast vergessener Dichter. An seine Poesie – sechzehn Einzelbände und Sammlungen – erinnert in deutschsprachigen Übersetzungen nur noch weniges. Es gibt den Gedichtband ’ (Tag um Tag), drei schmale Sammelbände und ein dem Anlass geschuldeter Prachtband in der Sammlung Nobelpreis für Literatur. Das heißt, sie gibt es eigentlich schon nicht mehr, denn diese bereits in den fünfziger bzw. sechziger Jahren verlegten Bände kann man heute nur noch in einigen Exemplaren antiquarisch ergattern. Fragt man im aktuellen Buchhandel nach Büchern des italienischen Nobelpreisträgers, erhält man nur ein bedauerndes Achselzucken. Umso verwunderlicher, dass kein einziger deutschsprachiger Verlag zum einhundertsten Jubiläum Quasimodos auf den Gedanken gekommen ist, wenigstens einen Band dieser europäischen Poesiegeschichte wieder auf den Buchmarkt zu bringen. –
Salvatore Quasimodos Schreibbeginn liegt in der Blütezeit des italienischen Neosymbolismus oder Hermetismus, wie ihn ein damaliger Literaturhistoriker bald taufte. Von den anderen beiden großen Dichtem der italienischen Moderne, Eugenio Montale und Guiseppe Ungaretti, lagen die ersten bedeutenden Werke bereits vor. Für die meisten Italiener galt zu dieser Zeit der Hermetismus als die lyrische Poesie überhaupt. Quasimodo fügte den Färbungen dieser sogenannten »traumhaften Unendlichkeit« eine eigene, unverwechselbare Schattierung hinzu.
Mir schien, dass sich auftaten Stimmen, Dass
Lippen nach Wasser begehrten, Dass
Hände zum Himmel sich reckten.
Was für Himmel! Weißer als die Toten Die leise mich immer wecken;
Mit nackten Füßen schaffen sie’s nicht weit.
Gazellen soffen aus den Quellen;
Durchsuchte Wind die Wacholder,
Und Zweige erhoben die Sterne?
Das eben gesprochene Gedicht übertrug, nebenbei bemerkt, Thomas Kling, der dem Gedicht und seinem Autor einen Essay im kürzlich erschienenen Band Botenstoffe widmete. Laut Kling hätten wir für einen möglicherweise doch noch interessierten Verlag einen fach- wie sprachkundigen Übersetzer in petto.
In ihrer Dichtung suchten die Hermetiker nach einem mythischen, einem »unschuldigen Land« – Quasimodo wurde in ein solches hineingeboren. Er stammt aus der Nähe von Syrakus auf Sizilien, das im Altertum zur Magna Graecia gehörte. Das Kind wuchs somit unmittelbar an den Quellorten antiker Poesie auf, der Dichter übernahm später vom Hellenismus die Fülle des Lichtes, die geschmeidige Formung der Verse, die Körperbezogenheit wie Körperfreude und die orphische Stimmlage. Jene örtliche Berührung mit lebendiger Tradition war es auch, die Quasimodo zu Übersetzungen klassischer Werke anregte, unter anderem übertrug er ausgewählte griechische Lyrik, Catull, Ovid, Vergil, Sophokles, das Johannesevangelium und Shakespeare.
Während er als staatlicher Baubeamter jahrelang kreuz und quer Italien durchstreifte oder nachdem er im nördlichen Mailand als Literaturprofessor an der Musikhochschule ansässig geworden war, blieb für Quasimodo die Sehnsucht nach dem Land seiner Herkunft deshalb immer eine reale. Doch wenn er von seinem Exil sprach, meinte er mehr die Einsamkeit, die einen Dichter befällt, der im feindseligen Land einer entweihten Sprache lebe, was ihn zur täglichen Mühsal zwänge in Tiefen zu steigen, um geheime Laute zu nähren. Den Hermetikern dienten die Worte nicht nur zur Bezeichnung von Mitteilbarem, sondern jedes Wort galt ihnen, wie schon ihr romantischer Vorläufer Novalis schrieb, als ein Wort der Beschwörung. Das Verschleiernde, Rätselhafte, das man dieser Dichtung missbilligend nachsagte, wollte aber keine überhebliche Distanz zum Leser schaffen. Vielmehr setzten Hermetiker oft ungewöhnliche und dem alltäglichen Gebrauch entgegengesetzte Analogien ein, um die Empfindungs- und Vorstellungskraft der Leser zu mobilisieren. So stellte Quasimodo mit Vorliebe ein einziges Adjektiv so genau zwischen zwei Verben oder Substantive, dass beide von dieser Charakterisierung etwas abbekamen. Das hinterließ eine Unsicherheit in der Lektüre, aber auch den Reiz eines ungewöhnlichen emotionalen wie mentalen Echos. Spürbar in der Poesie Quasimodos sind ebenfalls die katholischen Traditionen des Südens, wo Formen des Madonnen- und des Totenkults noch immer im Alltag lebendig waren. Das bewirkte einen unvoreingenommenen begrifflichen Umgang mit Trauer, Erbarmen oder Tod in seinen Gedichten.
Alles das waren Voraussetzungen und Prägungen, die sich auch in den späteren Arbeiten Quasimodos nicht verlieren. Selbst dann nicht, als sich sein poetisches Credo nach den bitteren Erfahrungen des zweiten Weltkrieges noch einmal von Grund auf wandelt. In dem 1947 erschienenen Band Giorno dopo giorno, jener bereits erwähnte, einzige vollständig ins deutsche übertragene Gedichtzyklus Quasimodos, geht die zunächst abstrakt wahrgenommene in eine zunehmend real zu verarbeitende Welt über. Folglich hieß der nächste erscheinende Band La vita non e sogno (Das Leben ist kein Traum). Unter den Einflüssen der Zeit hatte sich für Quasimodo das Leben von einem der Erinnerungen, Sehnsüchte und symbolischen Räume in ein Leben mit radikalen Verantwortlichkeiten verändert. Seine Worte wurden klarer, realistischer, einfacher; sie verloren damit aber auch ein wenig an poetischer Magie und dichterischer Unverwechselbarkeit. Quasimodo zählt zu den seltenen Dichtern, die sich nahtlos zwischen Gegenwart und Vergangenheit – zwischen diesen beiden so unterschiedlichen, ja sich ausschließenden zeitlichen Polen – hin und herbewegten und die ihre poetische Energie aus der Unmittelbarkeit dieser Berührung schöpften. Besonders dafür erhielt er den Nobelpreis zugesprochen, sehr zur Verwunderung der italienischen literarischen Öffentlichkeit, die eher Ungaretti favorisierte. Quasimodo bekam ihre Ablehnung deutlich zu spüren. Und schrieb seitdem kaum noch, sondern reiste in den letzten Jahren seines Lebens rastlos umher. 1968 starb er in Amalfi in der Nähe von Neapel.
Cornelia Jentzsch, Deutschlandfunk, 20.8.2001
Porträtgalerie
Nachruf
Gedenktage
Zum 100. Geburtstag des Autors:
Cornelia Jentzsch: Still ist die alte Stimme
Deutschlandfunk, 20.8.2001
Thomas Kling: Nackte Stimme, dir gehorch ich
Süddeutsche Zeitung, 20.8.2001










