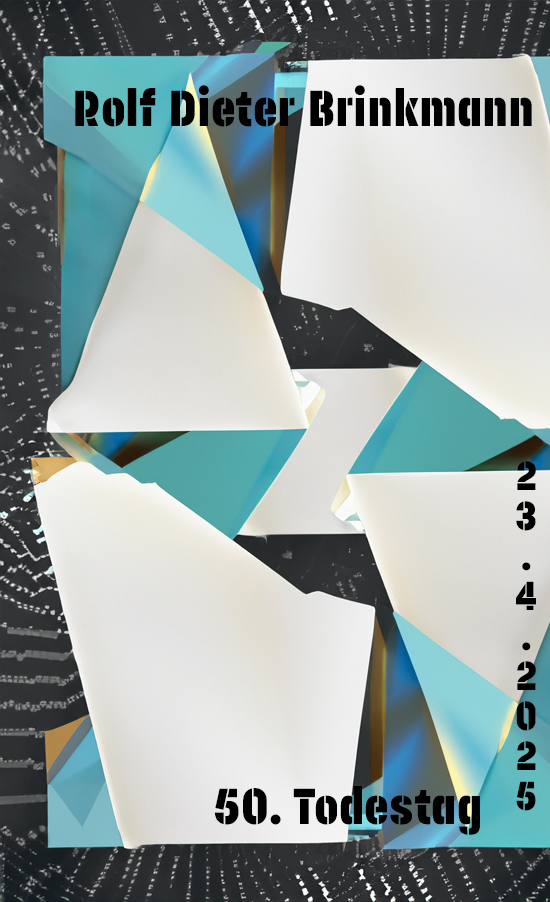
So viel Genie muss sein
– Der einzige proletarische Dichter, den sich die Nachkriegsliteratur geleistet hat, unübertroffen in seinem Zorn, kam bei einem Unfall ums Leben – vor genau fünfzig Jahren: Zwei neue Bücher erinnern an Rolf Dieter Brinkmann. –
Es hätte auch alles gut werden können. Mit achtzehn schon Angestellter beim Finanzamt Oldenburg, Anfangsgehalt DM 174,- zzgl. DM 68,- Ortszuschlag, nicht ohne Aufstiegschancen. Nach der Probezeit stellte ihm der Chef ein schönes Zeugnis aus:
Brinkmann ist willig, gewissenhaft und dienstfreudig.
Es ging aber nicht gut. Vor fünfzig Jahren, als er in London die Westbourne Grove überqueren wollte, eine fast schnurgerade Straße in Notting Hill, sie kam schon 1968 in seinem Roman vor, erfasste ihn ein Auto. »I think, he’s dead«, sagte die Frau, die zuerst bei ihm war. Rolf Dieter Brinkmann wurde 35 Jahre alt.
Geboren 1940 in Vechta im tiefsten Niedersachsen, und dann auch noch katholisch. Kein nennenswerter Geld- oder Bildungshintergrund, schon gar keine Gainsboroughs, »unter dem latenten dumpfen Todesdruck und einer namenlosen Bedrohung aufgewachsen«, von der Schule geht der Blick aufs Gefängnis. Brinkmann kam unversehrt aus dem Krieg, ein Jahrgang mit Gudrun Ensslin und Rudi Dutschke, und wie sie hat er den Nachkrieg nicht überlebt. Auch Gudrun Ensslins Freund nicht, Bernward Vesper, der Die Reise (1977) aus sich herausgestoßen hat, das Buch einer ganzen Generation, wie Heinrich Böll meinte. Danebenzulegen wäre Brinkmanns Rom, Blicke, ebenfalls ein unlesbarer Materialberg, Schreiben als einzige Überlebensmöglichkeit, Schreiben als letztlich erfolglose Selbsttherapie.
Nur dieser beiden Bücher wegen wäre jeder kurrente Literaturbegriff zu erweitern: Eigentlich völlig unlesbar, und doch die maßgeblichen Texte des vergangenen Halbjahrhunderts, auf die seltsamste Art gleich gestimmt. Vesper wollte sein Nazivater-Hassbuch im März Verlag herausbringen, weil dort 1969 ACID erschienen war, eine Anthologie neuester amerikanischer Lyrik, »ein großartiges Buch. Ich gratuliere den Herausgebern und Übersetzern.« Das waren Brinkmann und Ralf-Rainer Rygulla.
Michael Töteberg und Alexandra Vasa unternehmen in ihrer akribisch recherchierten neuen Biografie Rolf Dieter Brinkmanns eine Expedition ins vorige Jahrhundert mit seiner überraschenden Toleranz schon beim leisesten Genieverdacht. Mit bereits vollentwickeltem Hochmut schreibt Brinkmann, gerade 16 geworden, an Gottfried Benn, um ihn davon in Kenntnis zu setzen, dass er, Brinkmann, sein Gedicht »Fragmente« lese und ihm danke (»Immer!«) für die »Seelenauswürfe«. Wie er an Peter Suhrkamp schreibt und an Hans Bender von den Akzenten und ein gutes Wort erhascht ausgerechnet vom biederfrommen Manfred Hausmann, schließlich nach vielem Mühn die Aufmerksamkeit von Dieter Wellershoff erringt, einem Dr. phil., aber ebenfalls mit Benn bekannt, jetzt Lektor bei Kiepenheuer & Witsch, der, unterstützt von Renate Matthaei, den Schulversager und Buchhandelslehrling schreiben lässt, fördert, finanziert, ihn vor allem erträgt.
Natürlich war er unerträglich, so viel Genie muss sein. Sonst hatte er ja nichts. Was er zum Leben brauchte, holte er sich aus der Literatur bei Hans Henny Jahnn, Céline, Pound und e.e. cummings. Bücher nähren bald den ganzen Mann. Im Keller der Münsterbuchhandlung in Essen kann er die Suhrkamp-Lieferung am Geruch von der Rowohlt-Lieferung unterscheiden. In Keiner weiß mehr, 1968 erschienen und noch 1979 in der Bibliothek des Instituts für Deutsche Philologie der Münchner Universität nur mit dem Nachweis zu lesen, dass man das 18. Lebensjahr vollendet habe, in diesem einzigen und einzigartigen Roman erscheint die Buchhandlung »mit dem muffigen, dunklen Keller unter dem Laden, wo er fast drei Jahre lang nur Pakete aus- und eingepackt hatte, diesem zellenartigen Kabuff neben dem Packraum, das vollgehängt war mit diesen erbärmlichen, widerlichen Heiligenbildern, auf Holz aufgezogenen Drucken von Ikonen, schöne Stücke, jeden Herbst eine neue Kollektion, mit Kreuzen und Bündeln Rosenkränzen…«
An diesem locus amoenus verbuchbrüdert sich der literatursüchtige Lehrling Brinkmann in einem kulturschänderischen Ritual mit dem Lehrling Rygulla, hier beginnt der Dichter und Weltabweiser Brinkmann. Einen Wildling wie ihn würde die Kultur, in die er ums Jahr 1960 hineindrängte, heute nicht mehr verkraften. Saudumme Sprüche über Frauen hat er auch gemacht. Brinkmann war, Brinkmann ist einer der wenigen proletarischen Autoren, die sich die deutschsprachige Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet hat, unverschämt im Auftreten und dann wieder schüchtern aus Angst, dass man ihm den fehlenden Bildungshintergrund anmerken könne. »Schreckensmänner« waren sie nach der Maßgabe von Arno Schmidt, Thomas Bernhard war auch so einer, und eine Schreckensfrau wie Marianne Fritz gehört dazu. Gibt es nicht mehr.
Brinkmann war der Schlimmste, unerträglich arrogant, zwängte sich zuletzt viel zu dick in einen Anzug, der lachhafte Versuch, sich als Dandy von seiner langhaarigen, kiffenden, politisierenden Generation abzusetzen, ein »D’Annunzio aus Vechta/Oldenburg«, wie sein zeitweiliger Freund Hermann Peter Piwitt spottete. Gegen die Literaturbetriebsliteratur will er mit einem Mal »präzise« auftreten, »distanziert, exakt gekleidet, rasiert, die Gedanken geordnet«. Genau das gelingt ihm zum Glück nie, bloß keine Ordnung, stattdessen ein nie unterbrochenes Tagebuch, Briefe, Notizen, Verwünschungen, Abhandlungen, Seelenauswürfe natürlich.
Der Nachlasskoloss Rom, Blicke (1979) ist ein einziger Hassausbruch, kunstlose Kunst, aber eben nicht die für ein paar Monate eingeflogene Kunsthandwerksproduktion, sondern voller Glauben an die Kraft der reinen Literatur und dabei willig, gewissenhaft und diensteifrig. »Mama Roma ist eine langweilige Bar mit lungernden Typen, die sich am Sack kratzen und warten, was passiert«: So schreibt man sich mit aller Macht aus dem Literaturbetrieb heraus. Das war in Rom 1972, Villa Massimo, die Krönung deutscher Kulturförderung. Brinkmann konnte kein Wort Italienisch und die heiligen Steine, sie sprachen einfach nicht zu ihm. Statt von Bernini und Michelangelo zu schwärmen, ärgert er sich über die Mitstipendiaten und deren Frauen, über die ewig »sackkratzenden Italiener« (die damit wenigstens in die deutsche Literatur eingegangen sind), über den vorgeschriebenen Goethe natürlich:
dieses Arkadien ist reinste Lumpenschau.
Gut so, er hat mit seinem Aufenthalt in der Villa Massimo den Nachfolgern die Preise verdorben, dieser Weltekel, dieser Gegenwartshass war nicht mehr zu toppen.
Wie bei allen früh verstorbenen Genies die graubärtige Frage: Was aus ihm noch hätte werden können. Ja, was? Sogenannte Jahre der Reife, ein Alterswerk, das Bundesverdienstkreuz wenigstens? Mit 85 wäre er womöglich, wahrscheinlich, bestimmt selber einer der von ihm so verachteten »hässlichen, zynischen alten Männer des Kulturbetriebs«. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Zorn altert schlecht, fragt Achilles, aber es gibt seine jugendfrischen Gedichte, es gibt Rom, Blicke.
Es ist ein böser Witz, dass der Mann, der einst ins Arbeitsleben gedrängt werden sollte, weil er das Gymnasium nicht schaffte, der kein noch so kleines Latinum und überhaupt keinen Abschluss vorzuweisen hatte, der zuletzt gepfändet und von allen verlassen war, weil er unbedingt in die Literatur wollte, heute schätzungsweise 11,42 Prozent der aktuellen Germanistik ernährt, die sich tapfer mit »Intermedialitätsforschung« beschäftigt und sich über die „homodiegetische Erzählinstanz“ bei einem Dichter verbreitet, der gern einfach Gedichte geschrieben hätte, »viele Gedichte, so einfach geschrieben wie Songs«. Dann doch lieber schamlose Bewunderung wie bei Frank Schäfer, der Brinkmanns Leben als »Zettelkasten« nachempfindet.
Bei seinem letzten Auftritt, vier Tage vor seinem Tod, las er in Cambridge zwei Gedichte aus Westwärts 1 & 2, das im Mai 1975 erscheinen sollte. Er hatte ein Vorausexemplar, vorn ein gelbes Blatt eingezogen, ein ganz gelbes Blatt, darauf nur das Verlagssignet. Er stellte die Frage, was passiert, wenn das Gedicht aus ist, wenn die Literatur nicht mehr da ist. Dafür beschwor er den Geist des großen Jim Morrison, gestorben vier Jahre vor ihm, und seinen elf Minuten langen Song: »When the music’s over… turn out the lights.« Der namenlose Schrecken, wenn es aus ist.
Es ist aber nicht aus, denn Brinkmann denkt in all dem Hass, dem ganzen Brinkmannzorn, an »diese wachen Traumzustände, so war trotz aller Öde der unmittelbaren Umgebung immer der Gedanke da, dass es diese lebendige und bunte Welt geben muss«. Es gibt sie, in den einfachen Liedern, wie nur er sie geschrieben hat.
Was für Entzückungen, eine Straße entlangzugehen, während die Sonne scheint.
Doch, ich glaube, er lebt. Brinkmann lebt.
Willi Winkler, Süddeutsche Zeitung, 23.4.2025
Lebenslauf
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + Kulturstiftung + Archiv + Internet Archive + IZA + Kalliope + weiteres 1, 2 & 3
Porträtgalerie
Nachrufe
Dieter Wellershof: Alleinsein ist wie ein Gas, das ausströmt
Kölner Stadt-Anzeiger, 26./27.4.1975
Hans-Bertram Bock: Der Tod in Londons City
Nürnberger Nachrichten, 26./27.4.1975
Marcel Reich-Ranicki: Aber ein Poet war er doch
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.4.1975
Wolf Wondratschek: Er war too much für euch, Leute
Die Zeit, 13.6.1975
Günter Herburger: Des Dichters Brinkmann Tod
Die Zeit, 13.6.1975
Gedenktage
Zum 25. Todestag des Autors:
Alex Rühle: Die Welt als Rohmaterial
Süddeutsche Zeitung, 15.4.2000
Werner Olles: Unstillbare Sehnsucht
Junge Freiheit, 21.4.2000
Zum 30. Todestag des Autors:
Peter Henning: „Ich bin ein Dichter!“
Basler Zeitung, 23.4.2005
Ulrich Rüdenauer: In ein anderes Blau
literaturkritik.de, Nr. 5, Mai 2005
Ulrich Rüdenauer: Der große Außenseiter
Deutschlandfunk, 13.4.2005
Galerie Foto Gezett
titelmagazin.com, 22.4.2005
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Markus Fauser: Er war kein Urvater des Pop
literaturkritik.de, 1.4.2015
Theo Breuer: Flickenteppich · Blicke auf Brinkmann
poetenladen.de, 14.4.2015
Jens Uthoff: Der Wortvandale
die tageszeitung, 16.4.2015
Stefan Lüddemann: James Dean der deutschen Literatur?
Neue Osnabrücker Zeitung, 15.4.2015
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Gerhard Henschel: Träume von Grünkohl
junge Welt, 16.4.2020
Sascha Seiler: Die Tiere sind unruhig!
literaturkritik.de, 16.4.2020
Zum 50. Todestag des Autors:
Frank Schäfer: Brinkmanns Brandflecken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 + 13
junge Welt
Martin Oehlen: Rolf Dieter Brinkmann – Ein Ich, das querliegt zur Welt
Kölner Stadt-Anzeiger, 5.4.2025
Paul Jandl: In Italien hat der Dichter Rolf Dieter Brinkmann einmal einen Militäreinsatz ausgelöst. Vor fünfzig Jahren kam er in London unter ein Auto
Neue Zürcher Zeitung, 19.4.2025
Eckhard Schumacher: Der erste Popliterat
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.4.2025
Eckhard Schumacher: Der erste Popliterat
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.4.2025
Andreas Wirthensohn: „Ich, Diether Brinkmann (geb. 1938)“
Die Furche, 5.4.2025
Lars Chowanietz: Ausstellung in Vechta: Diese Fotos geben einen tiefen Einblick in das Leben von Rolf Dieter Brinkmann
OM Online, 18.4.2025
Martin Oehlen: Rolf Dieter Brinkmann – Ein Ich, das querliegt zur Welt
Kölner Stadt-Anzeiger, 5.4.2025
Stefan Kunzmann: 50. Todestag des Dichterrebellen und Popliteraten Rolf Dieter Brinkmann
Tageblatt Letzëbuerg, 23.4.2025
Jonas Engelmann: Die Augen gehen auf
nd, 22.4.2025
Anton Thuswaldner: Ein Auto beendete ein rebellisches Dichterleben
Salzburger Nachrichten, 22.4.2025
Willi Winkler: So viel Genie muss sein
Süddeutsche Zeitung, 23.4.2025
Georg Leisten: Gedichte ohne Bäume
Südwest Presse, 22.4.2025
Richard Kämmerlings: Der Dichter zeigt herausforderndes Verhalten
Die Welt, 24.4.2025
Gisa Funck: Mit Zweifel an allem und Wut auf fast alles. Lange Nacht über Rolf Dieter Brinkmann
Miriam Zeh: Popliterat, Provokateur und Kultautor
Rolf Dieter Brinkmann. Der Dichter als Berserker und Kultfigur. Autorin der Sendung: Franziska Hirsbrunner, Gastgeber: Bernard Senn











