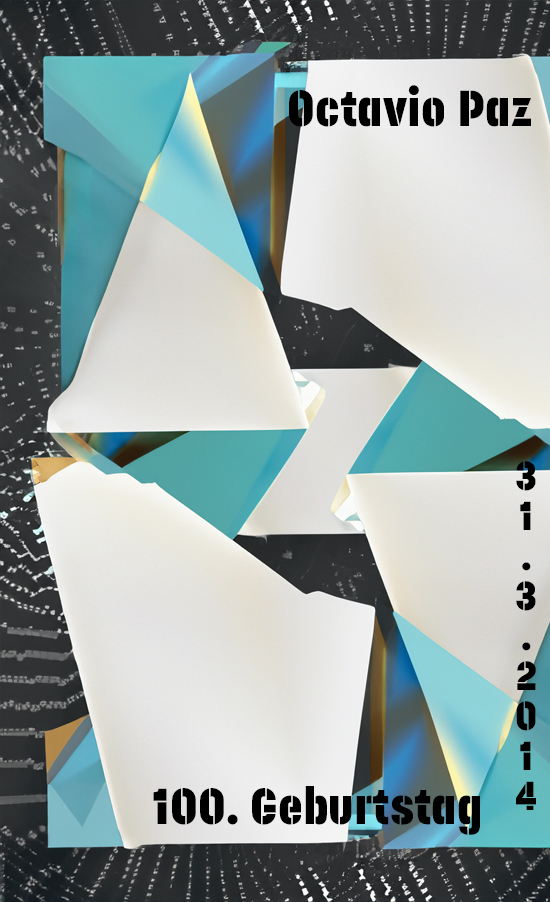
Belesenheit und Fantasie
– Vor 100 Jahren wurde der mexikanische Lyriker, Essayist und Diplomat Octavio Paz geboren. Sein reiches Werk hat das Potenzial, seine Leser lebenslang zu begleiten – ein Erfahrungsbericht. –
Im Oktober 1990 hielt ich mich in New York auf. Da gab es eine späte Hitzewelle, die vor allem ermüdete. In diesen Tagen besuchte ich einige Museen, unter anderem das Metropolitan Museum of Art. Beim Haupteingang dieses Museums warb eine große Schrift für die aktuelle Ausstellung: 30 Centuries of Mexican Culture. 3.000 Jahre mexikanischer Kultur wurden hier also präsentiert. Damals fanden an verschiedenen Orten in New York kulturelle Begleitprogramme zu dieser groß angelegten Mexiko-Ausstellung statt. Ich erinnere mich, dass ich die Zeitung Village Voice las und einen Vortragsabend mit Octavio Paz angekündigt sah. Der Ort der Lesung, eine kleinere Bibliothek, lag irgendwo in Midtown Manhatttan.
Diese Lesung habe ich nicht besucht. Die schwüle Hitze setzte uns zu und ich konnte mich nicht aufraffen, mit der Subway nach Midtown zu gelangen, die Bibliothek zu finden, und eine Lesung mit dem damals 76-jährigen Octavio Paz zu erleben.
Später bereute ich meine Trägheit, denn es wäre eine rare Möglichkeit gewesen, den mexikanischen Schriftsteller zu treffen. Ich hielt aber nie viel vom Fan-Getue, selbst bei Persönlichkeiten wie Octavio Paz, dessen großes Werk ich seit 1974 immer wieder, und auch von neuem, gelesen hatte.
Für mich war die Lektüre seiner Bücher in verschiedenen Phasen der vergangenen vierzig Jahre wichtig. Die Begegnung mit literarischen Werken geschieht ja durch Lektüre, Reflexion und Kritik des Gelesenen, und in einem genaueren Sinn durch das Schreiben über diese Bücher – oder durch das Übersetzen, das in meiner Sicht die genaueste Form des Lesens bildet.
Einige Jahre vor seinem New Yorker Vortrag hatte der mexikanische Dichter, Essayist und Philosoph ein monumentales Spätwerk vorgelegt: Sor Juana oder die Fallstricke des Glaubens (Sor Juana Inés de la Cruz, o, las Trampas de la Fe).
Dieses Buch beschreibt Leben und Werk der mexikanischen Nonne Sor Juana Inés de la Cruz (1651–1695), die als erste lateinamerikanische Dichterin spanischer Sprache Weltbedeutung erlangt hatte.
In seinem Werk beschrieb Octavio Paz aber nicht nur die Biografie Sor Juanas, sondern schilderte das Geistesleben in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts im »Vizekönigreich Neu-Spanien«, wie Mexiko offiziell bezeichnet wurde.
Einige Wochen nach der versäumten Begegnung in New York wurde im Herbst 1990 der aktuelle Nobelpreisträger bekannt gegeben: Octavio Paz. Aber es ist nicht meine Absicht, die Biografie des mexikanischen Autors, die vielfältig und abenteuerlich war, vorzustellen. Jeder daran interessierte Leser wende sich an Wikipedia.
Als Octavio Paz im Herbst 1984 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels in Frankfurt erhielt, veröffentlichte ich ein größeres Porträt über Paz, beschrieb darin seine Biografie und erwähnte einige seiner bedeutenden Bücher. Damals fiel mir auf, wie desinteressiert manche Redakteure und Leser waren, wenn es darum ging, sich mit dem umfangreichen Werk und der Person des mexikanischen Dichters zu beschäftigen. Für viele galt das bereits vor dreißig Jahren als uninteressantes Thema und ich wusste nicht, warum das so war.
Zu diesem Zeitpunkt, etwa 1984, erschienen im Suhrkamp Verlag eine Anzahl von Paz’s Büchern in guten Übersetzungen und schönen Ausgaben. (Als Übersetzer waren Fritz Vogelsang für die Lyrik, für die Prosawerke Rudolf Wittkopf zuständig.)
Aber die zwiespältige Rezeption seiner Werke blieb weiterhin bestehen. Warum nur? Damals war die Aufnahme moderner Literatur aus Lateinamerika um einiges wichtiger als heute, weil die bedeutenden Autoren, welche die Aufarbeitung der historischen Zusammenhänge Lateinamerikas (einschließlich Brasiliens und des vielsprachigen karibischen Raums) in neuen literarischen Formen erfunden hatten, größtenteils noch lebten und weiterhin veröffentlichten.
International erfolgreich waren vor allem Romane, und da wiederum diejenigen, die verständlich geschrieben waren. Die Werke von Paz passten nicht in diese Kategorie, da er bewusst keine Romane schrieb. In einem späten Aufsatz über Poetik vor der Wende zum 21. Jahrhundert lässt sich seine Verachtung des postmodernen Romans seit den 1980er Jahren nachlesen.
Sein eigenes Schreiben hatte um 1930 mit moderner Lyrik begonnen, später folgten viele Essays und kritische Werke, aber Paz blieb bis zum Lebensende beim Schreiben von Gedichten. Und da ist eine Entwicklung seines Werks im Zeitraum von über sechzig Jahren zu beobachten: der junge, avantgardistische Dichter Paz, in Mexiko während der 1930er Jahre lebend, wurde in den nachfolgenden Jahrzehnten von der endlosen Gelehrsamkeit und immensen Belesenheit des gereiften Kritikers, Essayisten, Philosophen und politischen Denkers Paz überlagert.
In Gesprächen mit lateinamerikanischen Lyrikern hörte ich in mehreren Ländern Lateinamerikas, inklusive Kuba, folgende Bemerkung über Paz: Das frühe lyrische Werk ist großartig, wurde genau zu dem Zeitpunkt geschrieben, als eine »internationale Moderne« zu entstehen begann, während der 1920er und 1930er Jahre. Paz hatte als Jugendlicher bereits die spanischen Modernisten (der Generation von 1927) gelesen und war vom Surrealismus beeinflusst. Diese Strömungen verwendete der junge Dichter, eine neue mexikanische Lyrik zu schreiben, die aus der eigenen kulturellen Erfahrung kam.
Die lateinamerikanischen Dichter-Kollegen stellten weiter fest: Später schrieb Paz bedeutende Essays, und vor allem 1957 das Langgedicht »Sonnenstein« (»Piedra del Sol«), ein Pendant zu T.S. Eliots The Waste Land oder Allen Ginsbergs Howl. Aber die späteste Lyrik des Meisters wäre vor lauter Belesenheit zu überfrachtet mit Anspielungen, sie wirke eigentlich als Kommentar zur lyrischen Sprache und weniger als originales, dichterisches Werk. Mit anderen Worten, dem reifen Schriftsteller stand seine riesige Bildung und sein gusseisernes Erinnerungsvermögen im Weg, wenn es um neue Gedichte ging.
Im Jahr 1950 veröffentlichte der 36-jährige, nunmehrige mexikanische Diplomat Paz sein erstes Prosabuch, den Essayband Das Labyrinth der Einsamkeit (El laberinto de la soledad). Mit diesem Werk wurde sein Name international bekannt, da bald Übersetzungen in andere Sprachen folgten. Dieses bis jetzt aktuelle Buch gibt eine Analyse des mexikanischen Charakters, damit der Kultur Mexikos. Paz ging damals von der Idee aus, dass erst die mexikanische Revolution, die im Jahr 1910 begonnen, aber bis in die 1930er Jahre angehalten hatte, eine moderne Republik gebildet hatte, aus der endlich eine selbstbewusste, unabhängige Nation entstehen könnte.
Die Beschäftigung mit der eigenen Herkunft, also mit Mexiko, zieht sich beständig durch das gesamte Werk von Octavio Paz. Es trifft auch auf ihn zu, was er 1950 im Labyrinth der Einsamkeit feststellte: dass der mexikanische Charakter trotz der zum Teil sehr blutigen Geschichte und Revolution konservativ, »wertbeständig«, traditionalistisch gesinnt ist, angereichert durch zwei historische Strömungen der Geschichte: der indianischen, der spanischen.
Hier möchte ich nun auf einen frühen Text von Paz zurückkommen, der mich über viele Jahre in seiner offenen Mehrdeutigkeit bewegt. Es ist ein Prosagedicht des früheren Werks, geschrieben 1949, als Paz bereits in Paris als »bescheidener Diplomat« lebte. Im Jahr 1960 veröffentlichte der Autor in Mexiko das Buch Adler oder Sonne? Der Titel bezog sich auf die zwei Seiten einer damals gebräuchlichen mexikanischen Peso-Münze.
Das Buch enthält drei Kapitel, das erste trägt den Titel »Arbeiten des Dichters« (»Trabajos del Poeta«). Der Abschnitt »XIII« beschreibt auf rätselhafte, surrealistische Weise die Gründung, das Leben und die nachfolgende Vernichtung einer altmexikanischen Stadt. Die mehreren »Schichten« dieser kurzen Erzählung (die Form ist ein »Prosa-Gedicht«) sind folgende:
Der Erzähler kommt von außerhalb, er ist größer und mächtiger als die Menschen, die dort wohnen. Der Erzähler erschafft, beobachtet und vernichtet.
Die Gesellschaft, die hier in wenigen Zeilen beschrieben wird, ist unzulänglich. Es gibt den lärmenden, dummen Pöbel und eine eitle, arrogante Oberschicht, die sich in unverständlichen und bigotten Zeremonien feiert. Das Prosa-Poem lässt sich wie eine Metapher auf jede moderne Gesellschaft lesen, wo immer nur Dummheit, Korruption herrschen, wo einander begünstigende Seilschaften an der Macht sind.
Der Text bezieht sich im Sinn des Autors nicht nur auf eine mexikanische Vergangenheit vor 1.000 Jahren, auch wenn das formal so wirkt. Ein weiterer Aspekt Alt-Mexikos ist die Angst vor Zerstörung und Vernichtung der Welt, die in den alten Büchern formuliert wurde.
Im Fall der Stadt Tilantlán war die Angst berechtigt, denn der Schöpfergott, der die Welt erzeugt hatte, war nach längerem Beobachten zum Schluss gekommen, dass es besser wäre, die verschlagenen Menschen wieder zu vernichten. Nun folgt der Text von Octavio Paz.
Vor Jahren errichtete ich aus Kieselsteinen, Schutt und Gräsern Tilantlán. Erinnere mich an die Stadtmauer, die gelben Türen mit den Zeichen von Fingern, die engen, stinkenden Gassen, die ein lärmender Pöbel bewohnte, den grünen Palast der Regierung und das rote Haus der Opferungen, offen wie eine Hand, mit seinen fünf großen Tempeln und seinen unzähligen Passagen. Tilantlán, graue Stadt am Fuß des weißen Felsens, eine Stadt, am Boden befestigt mit Fingernägeln und Zähnen, Stadt aus Staub und Gebeten. Ihre Bewohner – verschlagen, zeremoniös und cholerisch – verehrten die Hände, die sie erschaffen hatten, fürchteten aber die Füße, die sie vernichten könnten. Ihre Theologie und die neuen Opferungen, mit denen sie sich die Liebe der Ersteren erkaufen und sich des Wohlwollens der Letzteren versichern wollten, konnten nicht verhindern, dass eines fröhlichen Morgens mein rechter Fuß sie zermalmte, samt ihrer Geschichte, ihrer stolzen Aristokratie, ihren Aufständen, ihrer heiligen Sprache, ihren Volksliedern und ihrem rituellen Theater. Und ihre Priester hatten nie den Verdacht gehegt, dass Füße und Hände nur die Extremitäten desselben Gottes waren. [Der Text stammt aus dem ersten Teil des Buchs Adler oder Sonne? (1949) von Octavio Paz und wurde von Bernhard Widder übersetzt]
Der Text hat eine Beziehung zum Titelbild dieses »extra«. Es zeigt eine einzigartige archäologische Anlage im äußersten Norden Mexikos, auf der hochgelegenen Wüste von Chihuhua situiert. Es ist eine Lehmstadt, die den Namen »Paquime / Casas Grandes« trägt. Diese Stadt, vor 1.000 Jahren ein bedeutendes Handelszentrum mit besonderer Wasserversorgung aus naheliegenden Bergen, wurde im 10. Jahrhundert nach Christus gegründet und dürfte um das Jahr 1340 durch einen Überfall und Brände vernichtet worden sein.
Ich habe diese Anlage seit 1997 mehrmals besucht, und jedes Erlebnis war mehrdeutig und eindrucksvoll. Eine leere, strenge, abstrakte Landschaft, mit Temperaturen, die der Sahara entsprechen. Man weiß nichts über die ethnischen Gruppen, die Paquimé gegründet und erbaut hatten, und für einen Vortrag über die Stadt wählte ich den Text »Arbeiten des Dichters, XIII« von Octavio Paz aus, weil die Vernichtung einer Stadt ein Thema bildet.
Octavio Paz starb im Frühling 1998 in seiner Heimatstadt Mexiko (Stadt) im Alter von 84 Jahren. Die letzten fünfzehn Lebensjahre hatte er sich weiterhin mit beständigem Fleiß mehreren Buchprojekten gewidmet. Das große Werk über Sor Juana wurde bereits erwähnt. 1995 erschien sein zweites Buch über Indien, Im Lichte Indiens (En las Vislumbras de la India), das einen autobiografischen, einen kunst- und literaturhistorischen Teil hat.
Zu Indien hatte Paz eine besondere, sehr lange Beziehung gepflegt, die im Jahr 1951 begann, als der junge Diplomat einige Monate an der mexikanischen Botschaft in New Delhi arbeitete. Von 1962 bis zum Herbst 1968 lebte er als Botschafter Mexikos in Indien, konnte sehr viel reisen, forschen und studieren. Eine Reihe von Büchern entstand unter dem Einfluss indischer Philosophie in diesen Jahren, und dabei sei auf das sprachphilosophische Prosa- und Lyrikwerk Der sprachgelehrte Affe (El Mono Gramático) hingewiesen. Es ist dem hinduistischen Affengott Hanuman gewidmet.
Im Lichte Indiens wurde international als wesentliches Werk eines Ausländers über Indien gepriesen, und das Verdienst des Autors dabei beschränkt sich nicht nur auf die offene Darstellung seines eigenen Lebens in Indien, sondern auf kulturelle Vergleiche zwischen Mexiko und Indien, wobei mehr Gemeinsamkeiten existieren, als Europäer sich vorstellen können. Eine weitere Leistung ist seine Darstellung der indischen Philosophie und Literatur, die bis in die Gegenwart im Westen kaum bekannt ist.
Das Buch beginnt mit dem Kapitel »Bombay«, mit bemerkenswerten Sätzen:
1951 lebte ich in Paris. Ich hatte einen bescheidenen Posten in der mexikanischen Botschaft. Im Dezember 1945 war ich für sechs Jahre hergekommen; die Mediokrität meiner Stellung erklärt, warum man mich nicht nach zwei oder drei Jahren, wie es im diplomatischen Dienst üblich ist, in eine andere Stadt entsandt hat. Meine Vorgesetzten hatten mich vergessen, und im stillen war ich ihnen dankbar dafür…
Bernd Widder, Wienerzeitung, 8.3.2014
Porträtgalerie
Gedenktag
Zum 100. Geburtstag des Autors:
Bernhard Widder: Belesenheit und Fantasie
Wiener Zeitung, 28.3.2014
Peter Mohr: Romantiker in diplomatischen Diensten
titel-kulturmagazin.net, 31.3.2014











