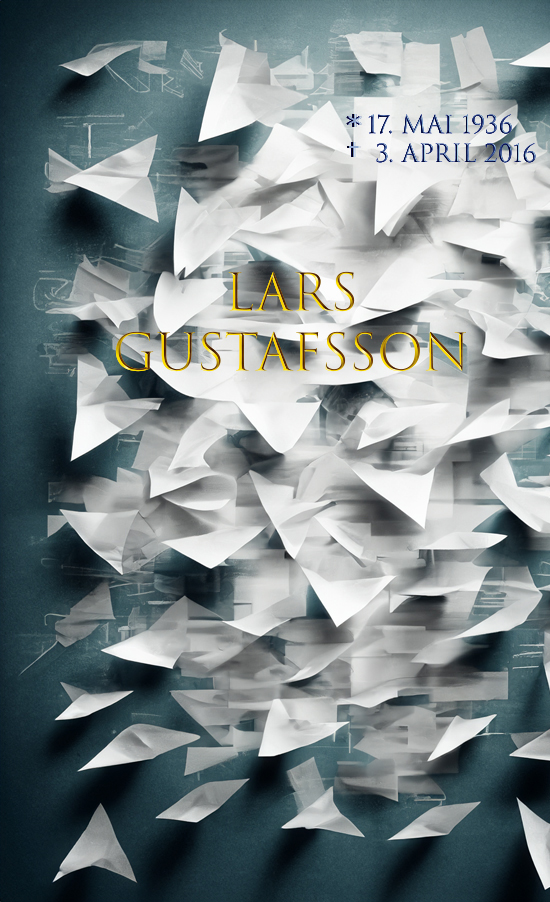
Der Pessimist, der ein Optimist war
– Er war ein Freigeist, dessen Sprache im deutschen Theorietheater der späten sechziger Jahre sofort auffiel. Der Hanser-Verleger Michael Krüger erzählt, wie er Lars Gustafsson ins Herz schloss und nie mehr losliess. –
In den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts habe ich Lars Gustafsson einmal in Västeras besucht. Als ich am Nachmittag am Bahnhof eintraf, war es bereits stockdunkel. Kein Taxi, kein Bus, aber vor allem kein Bahnhofsvorsteher, den ich hätte fragen können, wie und wo man den Dichter finden könne. Es gab damals noch kein Handtelefon, und die Festnetznummer hatte ich nicht dabei.
Wer nach Schweden fährt, so meine etwas naive Vorstellung, ist in diesem sozialdemokratisch regierten Land gut aufgehoben und wird prinzipiell pünktlich abgeholt. Also setzte ich mich in den eiskalten Warteraum und tat, was man in Warteräumen tut: Ich wartete. Der Unterschied zu Stockholm fiel einem natürlich sofort ins Auge, ausserhalb der Hauptstadt, so mein von Vorurteilen geprägtes Fazit, war offenbar alles Provinz. Die kontinentale Bahnhofskultur jedenfalls mit Restaurant, Kiosk und Kaffeebar gab es hier nicht. Es gab nur Dunkelheit und Kälte.
Ich hatte im Duty-free eine Flasche Whisky gekauft, Johannes der Spaziergänger, wie Reinhard Lettau immer zu sagen pflegte, der mich zehn Jahre zuvor mit Lars Gustafsson bekanntgemacht hatte. Diese Flasche war in Schweden damals ein Vermögen wert, entsprechend sorgfältig schraubte ich sie auf, um einen ordentlichen Schluck gegen die Kälte zu nehmen. Das Geräusch beim Aufschrauben, Metall auf Glas, zusammen mit dem Geist des Alkohols, der sich ungehindert in der kahlen Halle ausbreiten konnte, hatte eine phänomenale Wirkung. Plötzlich gingen wie in einer venezianischen Komödie überall Türen auf, aus denen Menschen traten, die alle auf mich zuströmten, um sich an meiner Wärmequelle zu laben. Und als die Flasche im Handumdrehen leer war, kam auch Lars.
Hans Magnus Enzensberger, der einige Jahre in Norwegen gelebt hat und Schwedisch spricht, hatte mit seiner Übersetzung von Gustafssons Gedichtband Die Maschinen den Autor 1967 mit einem Schlag bekannt gemacht. In Schweden hatte der bereits ein halbes Dutzend Bücher veröffentlicht, Gedichte, Romane, Erzählungen und Essays, und als Herausgeber der Zeitschrift Bonniers Litterära Magasin war er berühmter als viele der Mitglieder der Schwedischen Akademie. (Es gehört zu den Seltsamkeiten dieser Akademie, dass sie den drei auch im Ausland angesehenen schwedischen Schriftstellern Per Olov Enquist, Lars Gustafsson und Tomas Tranströmer nie die Tore und damit auch den Zugang zu den Weinkellern geöffnet hat.) Dem Gedicht »Die Maschinen« hatte Lars Gustafsson einen Kommentar beigegeben, der damals schnell in aller Munde war. Der letzte Satz lautete: »Die Tragik des Menschen, wie die der Maschinen, liegt darin, dass er kein Geheimnis hat.«
Das war zu einer Zeit, als die Neue Innerlichkeit nicht nur in der Poesie ausgerufen wurde, die Rückbesinnung aufs Ich als »haven in a heartless world« – ein Aspekt, den man übersehen hatte: »Unsere Worte«, schrieb Gustafsson, »bergen keine unzugänglichen Reste und keine privaten Bedeutungen. Die Sprache schöpft uns aus. Sie ist das Unpersönliche in uns, und unsere Gedanken existieren nur in diesem unpersönlichen und gleichsam objektiven Medium. Es denkt in uns. Eine solche Betrachtungsweise muss zu einer Poetik führen, die sich von der des hergebrachten, ›klassischen‹ Modernismus unterscheidet.«
Wer nun aber denkt, Lars Gustafsson sei einer von den asketischen, phantasielosen Menschen gewesen, die nur und ausschliesslich auf der Geheimnislosigkeit der Welt bestehen, der irrt sich gewaltig. Es hängt sicher auch mit dem neugierigen Interesse deutscher Leser an seinen Büchern zusammen, dass er die Hochebene der Abstraktion, wie er sie aus der Beschäftigung mit der Logik und der Sprachphilosophie kannte, verliess, um sich politischen und sozialen Problemen zu widmen.
1974 erschien ein Briefwechsel mit dem schwedischen Marxisten Jan Myrdal über Die unnötige Gegenwart, in dem Myrdal die These entwickelt, dass die Zeit zwischen der Revolution von 1848 und heute eine sinnlos verlorene Zeit gewesen sei.
Gustafssons Entgegnung ist ein Musterbeispiel für die Art seines Denkens in anschaulichen Beispielen: »In einer kanadischen Fabrik gab es ein paar Arbeiterinnen, deren Aufgabe es war, Maschinenteile in Seifenwasser zu spülen. Tagein, tagaus standen sie dort und spülten, ihre Finger schmerzten immer mehr und verkrümmten sich durch Rheumatismus im fortgeschrittenen Stadium, was die unausbleibliche Folge ist, wenn man die Finger den ganzen Tag im kalten Wasser hat. Eines Tages sieht ein junger Ingenieur diese Tortur und sagt: So geht das nicht. Ab morgen lassen wir warmes Wasser in die Behälter fliessen. Dies hatte einen gewaltigen Streik in der ganzen Fabrik zur Folge. Das könnte unlogisch erscheinen, ist es aber nicht. Solange diese Arbeiterinnen ihre abscheuliche Arbeitssituation als notwendig ansahen, ertrugen sie sie. Unerträglich wurde es in dem Augenblick, als sie erkannten, dass dies alles unnötig war. Der Tag, an dem die Völker Europas die gleiche Entdeckung machen wie die kanadischen Arbeiterinnen, wird ein entsetzlicher Tag sein.«
Gustafssons Briefe waren in Berlin geschrieben worden, wohin er 1972 für zwei Jahre mit seiner Frau Madeleine – einer Kritikerin, Übersetzerin und Dichterin – übersiedelt war. Mit seiner Art, gegen den Strich zu denken, fand er bald viele Freunde unter den Schriftstellern, die damals in Berlin lebten: Neben Enzensberger waren das Frisch und Lettau, Johnson, Grass und Höllerer. Gustafsson empfand diese unkomplizierte Art des Umgangs nicht nur als inspirierend, sie war lebensnotwendig, wie er in seinem in Berlin entstandenen Roman Herr Gustafsson persönlich bekannte. Offenbar war ihm das damals provinzielle Schweden auf den Geist gegangen. »Nichts hat mein Bewusstsein und meine Entwicklung während der letzten Jahre so stark geprägt wie dies: in einem Land zu leben, wo ›Sozialismus‹, ›Gerechtigkeit‹ und ›Demokratie‹ in jeder Festrede so hochgehalten werden und wo man zugleich in der politischen Realität mit einer solchen Rücksichtslosigkeit darauf scheisst wie in Schweden.«
Jetzt also »das narbige, das kluge Berlin mit seinem lebhaften, scharfen Intellekt, mit seinen revolutionären Gruppen, marxistischen Kinderläden, anarchistischen Kommunen, seinen blauen, roten, weissen Pamphleten, seinen Strassencafés und Buchhandlungen, Berlin, diese geheimnisvolle Schmiede zukünftiger Kräfte, eingesperrt hinter hohen Mauern und Minengürteln inmitten endloser Kartoffeläcker, dieses Berlin, das alles weiss, alles erfahren und seit langem seinen Zustand akzeptiert hat«. Und Lars mitten drin.
Er, der in den sechziger Jahren in der angelsächsischen Erkenntnistheorie gehaust hat, »wie man in einem heruntergekommenen Hotel haust, ohne Enthusiasmus«, war am Ende und auf der Suche nach einem Ausgang, einem offenen Fenster. »Ich wusste noch nicht, dass der Augenblick, in dem wir die Tiefe unserer Verzweiflung erkennen, ein hoffnungsvoller Augenblick ist. Plötzlich die Trauer in ihrem ganzen entsetzlichen Ausmass zu sehen, heisst, am Schluss angekommen zu sein.« Es war diese Sprache, die in dem damals in Deutschland aufgeführten Theorietheater sofort auffiel: der Gustafsson-Sound.
Ich glaube, trotz dem damals einsetzenden Erfolg seiner Bücher, vor allem in Deutschland, trotz den verbesserten Lebensumständen konnte er seine Melancholie nicht wirklich besiegen. Er versuchte, sie sich mit einer beängstigenden Produktivität vom Hals zu schreiben, manchmal erschienen zwei Bücher in einem Jahr. Aber der Riss in der Mauer, wie er sein in Berlin begonnenes Romanprojekt nannte, war nicht zu kitten.
In den Briefen an Myrdal taucht diese Metapher zum ersten Mal anlässlich der Lektüre neuer Gedichte von Tomas Tranströmer auf: »Nicht unähnlich einem Sisyphus versucht der Dichter wieder und wieder den steilen, entgleitenden Abhang einer Art innerer Sandgrube emporzuklettern, hinauf zu etwas, das er zu fassen bekommen will, und immer wieder gleitet er ab. Tomas Tranströmers Lyrik handelt von den schmalen Rissen in den Mauern eines von fremden Mächten okkupierten Alltags. Sie drücken, möchte ich sagen, das Gefühl aus, dass etwas unser Leben okkupiert hat, sie drücken das eingeschlossene Freiheitsbedürfnis aus, das sich in Ermangelung von Hoffnung und in Ermangelung von Handlung nach innen wenden muss, zu den unterbewussten Schichten, wo es noch Farben gibt, wo die Kindheit ist.« Und er bekennt: »Diese Haltung, dieses ganze Fluchtbedürfnis ist mir so vertraut, dass ich meine, die Gedichte früher schon gelesen zu haben, auch wenn sie neu sind.«
Als wir sein Haus erreichten, trafen wir nicht nur auf ein Team einer deutschen Fernsehanstalt, das einen Film über ihn drehte, sondern auch auf Tomas Tranströmer, der mit seiner Frau Monica ganz in der Nähe wohnte. Im Kamin prasselte ein Feuer, wir tranken in Ermangelung des erhofften Whiskys heissen Tee, Lars verschwand in einer Ecke des grossen Raumes und spielte auf seiner Querflöte Stücke von Bach, und ich besprach mit Tomas die Veröffentlichung seiner Gedichte in deutscher Übersetzung.
Wenn auch die Texte der beiden zu jener Zeit einen unerhört pessimistisch-existenziellen Ausdruck zeigten, so konnte von einem solchen Gemütszustand beim Gespräch in dem gemütlichen Haus nicht die Rede sein. Man fühlte sich wie in einer Arche, gerettet. Draussen tobte die ungerechte Welt, drinnen herrschte behagliche Wärme, Kultur, Freundlichkeit. Milder Himmel, rief Lars, wenn er einen Ton nicht traf. Andere sagen: verdammt, Gott im Himmel oder benutzen Kraftausdrücke. Lars sagte: milder Himmel, halb Ergebenheit, halb Anrufung.
Ich erinnere mich an die schüchterne Frage von Tomas, ob bei uns denn auch Bände gedruckt werden, die eher den Umfang von Heften haben, und höre noch die sonore Stimme von Lars, die Menge, die Tomas in einem Jahr produziere, würde er, Lars, mühelos an einem Tag schaffen. Und dann lachten beide wie die Kinder. Mir fielen die letzten Zeilen des Briefwechsels mit Myrdal wieder ein. Lars zitiert eine Freundin, die ihm am Telefon gesagt hatte: »Und im übrigen habe ich nie verstehen können, warum es irgendeinen Widerspruch zwischen Optimismus und Pessimismus geben sollte.«
So begann unsere Freundschaft. Über viele Jahre hinweg trafen wir uns zu den Jurysitzungen und Verleihungen des Petrarca-Preises, oft mit den Tranströmers, der ja selbst auch Preisträger war. Lars legte immer grossen Wert darauf, dass ein Tennisplatz in der Nähe des Hotels war, so dass ich annehmen musste, dass er ein guter Spieler war. Aber wer über die Philosophie des Aufschlags schreibt, muss nicht unbedingt selber gut spielen können. Sowohl Hubert Burda wie Reinhard Baumgart kamen verstört von diesen Matches zurück, weil Lars sie kribbelig gespielt hatte. Er spielt so unkonventionell, dass man darüber die Regeln vergisst und verliert, sagte der genervte Baumgart.
Eines Tages brachte Lars eine junge, dunkelhaarige Frau mit, klein und drahtig wie er, die er uns als »intelligenteste Vorsokratikerin Amerikas« vorstellte. Das war im Engadin, wo unter anderen Mazzino Montinari, der Nietzsche-Herausgeber und Kenner der Vorsokratiker, anwesend war. Gott sei Dank musste sie nicht über Heraklit referieren. Sie war Juristin und wurde seine zweite Frau; ihretwegen und wegen der beiden gemeinsamen Kinder trat Lars zum Judentum über, wenn man seine Entscheidung so ausdrücken kann, und blieb als Professor der Philosophie zwanzig Jahre in Austin, Texas, in den USA, die er, der Junge aus dem armen Västeras, selbst dann tapfer verteidigte, wenn es nichts zu verteidigen gab. »Wir fangen noch einmal an. Wir geben nicht auf« – dieses rebellische Motto aus den Rissen in der Mauer war wie weggeblasen.
Er schrieb weiter wunderbare Gedichte und eine Reihe von kurzen Romanen, die ich nicht so mochte wie sein früheres Werk. Es fehlte der melancholisch-klare Sound. Was vermisst du denn besonders, fragte er mich einmal, und ich antwortete: Die Beschreibung des Geruchs nasser Wollsachen in den Fluren der Schule und der Universität in Schweden! Ja, da hast du wohl recht, sagte er, diesen eigentümlichen Geruch verliert man aus der Nase, wenn man in Texas lebt.
Kaum war er zurück, beschrieb er wieder die morschen Boote, die blanken Eisflächen, die eigentümlichen Wolkenformationen, die Tintenpilze, die Güterzüge, die durch die Nacht fahren, und das seltsame Licht, das es nur in der schwedischen Provinz gibt. Kaum wieder in Schweden gelandet, nahm er den ersten besten Nachtexpress zurück in die Kindheit, wo Frau Sorgedahls schöne weisse Arme auf ihn warteten. Und wie selbstverständlich war auch der Sound in seinen Büchern wieder da, die altertümliche (nicht verletzende) Ironie, die schöne Umständlichkeit, mit der er die Dinge zu erfassen suchte.
Er heiratete noch einmal, eine Jugendfreundin, Agneta Blomqvist, die ein Landhaus besass, das Lars als »eine Art Versailles in der schwedischen Provinz«, das Agneta selber als solides Bauernhaus bezeichnete. Die Produktivität stellte sich wieder ein. Als ich ihm im vergangenen Herbst den Thomas-Mann-Preis überreichen durfte, schien er mir endlich rundum glücklich zu sein. Er strahlte wie ein Kind beim Kindergeburtstag, als Wolf Lepenies das Motiv des Fahrrads in seinen Romanen herausarbeitete. Er war wieder ein Kind geworden, das staunend den Reichtum der Welt bewundert, einer Welt, in der die Primzahlen, Rilkes Gedichte, verrostete Fahrräder, saubere und unsaubere Reime, Boshaftigkeit und Ungerechtigkeit, wie er sie in seinem Werk auf so unnachahmliche, eigentümliche Weise beschrieben hat, miteinander auskommen.
Michael Krüger, Neue Zürcher Zeitung, 17.5.2016
Porträtgalerie
Lesung
Gedenktag
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Habe keine Sensationen zu bieten
literaturkritik.de, Juni 2006
Thomas Fechner-Smarsly: Rochaden der Leichtigkeit
Neue Zürcher Zeitung, 17.5.2006
Lars Gustafsson 70
Die Welt, 17.5.2006
Nico Bleutge: Klare Luft
Der Tagesspiegel, 17.5.2006











