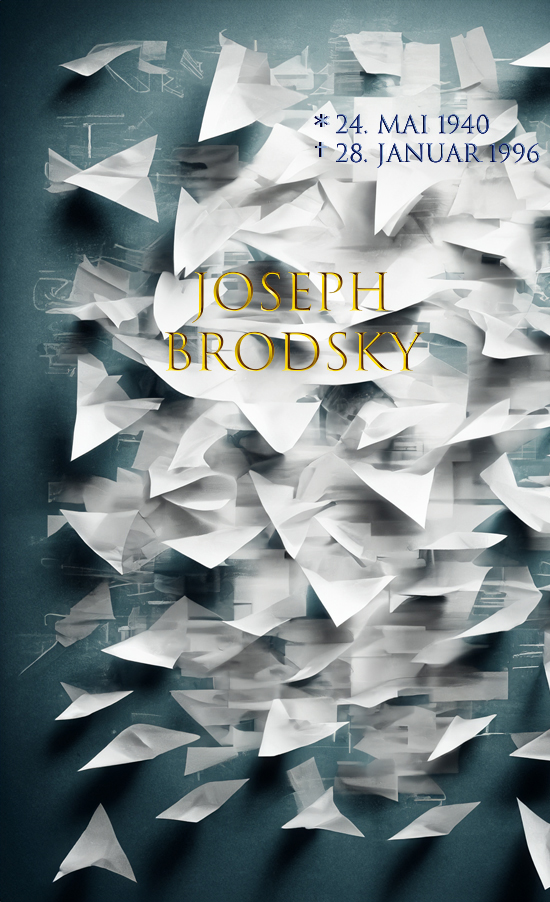
Die Muse lebt – nach dem Tod von Joseph Brodsky
Daß er die Jahrhundert-, die Jahrtausendwende nicht erleben würde, hat Joseph Brodsky, der Anfang des Jahres im Alter von knapp 56 Jahren gestorben ist, seit langem geahnt; gefürchtet hat er es nicht. »Bald endet das Jahrhundert, doch früher ende ich…«: Mit diesem Vers eröffnete er 1989 ein großes Gedicht (»Fin de siécle«), das einerseits als sarkastischer Abgesang auf unsere »traurigen Zeiten« zu lesen ist, andererseits als antizipierter Abschied des Dichters von einer verheerten, »schachmatt« gesetzten Welt, für die es kein »Vivat!« mehr gibt:
Das Jahrhundert ist bald von Deck.
Die Zeit verlangt in ihrem Verlauf nach Opfern und Trümmern. Baalbek
und der Mensch zu seinem eigenen Zweck
reichen ihr nicht. Wirf ihr dazu noch Gefühle, Gedanken und
Erinnerung in den Rachen. In ihrem Schlund
versinkt alles. Ein feiger Hund
bin ich nicht, sie kriegt von mir, was sie will. Und ich bin bereit,
notfalls – warum auch nicht – ein Stück Vergangenheit zu sein…
Vergangenheit zu sein – in Brodskys paradoxalem poetischen Denken bedeutet dies nicht weniger als »wirklich« zu sein; Wirklichkeit ist für ihn ein eher zeitliches denn räumliches Konzept, ist identisch mit dem, was je geworden, je gewesen ist, und in diesem Verständnis hat er sowohl die Existenz der Welt wie auch sein eigenes Leben stets vom Tod her gedacht, nämlich als »Synonym / des Nicht-Seins und als Regelbruch«. Oder klar und einfach so:
Zeit ist geschaffen durch den Tod.
Erst als Gewesener, als Gestorbener gewinnt der Mensch – gewinnt vor allem der Dichter – faßbare Gestalt, und diese Gestalt ist, wie Brodsky vielfach, mit Bezug auf sich selbst, betont hat, die Null, ein Nichts:
zeichne auf dem Papier einen leeren Kreis, das bin dann ich: innen leer. Schau ihn dir an und lösche ihn aus…
Oder:
Meine Absenz hat in der Landschaft kein großes Loch hinterlassen; zählt nicht; ein Loch – kein sehr großes…
Nach Brodsky ist der Dichter immer nur »der Held seines eigenen Mythos«, und dieser Mythos besteht für ihn darin, von der Sprache auserwählt zu sein, der Sprache als Medium, als Stimm- und Schreiborgan zu dienen, ihr solchermaßen »das Überleben« zu sichern. In zahlreichen Gedichten und Essays hat Brodsky – radikaler als irgendein anderer zeitgenössischer Autor – den Mythos des Wortkünstlers dekonstruiert, hat ihn zurückgeführt auf die schlichte Funktion eines »Sprachrohrs«, eines ,,körperlosen Beobachters«, eines »nominellen Eremiten«, eines »Schattens«, eines »Passanten«:
Falls ich überhaupt an mich dachte, dachte ich an mich als einen Nobody.
Ein Niemand zu sein, nichts Eigenes sagen zu wollen, ist nach Brodsky die Voraussetzung dafür, daß der Dichter dem Anspruch der Sprache gerecht wird, und das ist erst dann der Fall, wenn er sie – noch ein Paradox! – nicht mehr zu beherrschen versucht, vielmehr sich von ihr beherrschen läßt, so daß sie »zur Gänze« durch ihn sich artikulieren kann. Diese quasisakrale Sprachauffassung hat Brodsky, oftmals sich wiederholend, in verschiedensten Zusammenhängen vorgetragen, so auch mit Bezug auf den englischen ,,metaphysischen« Dichter John Donne, von dem er einmal schrieb, er sei ein Autor, »der nicht als Persönlichkeit, nicht als Person spricht«, der uns nicht »seine eigene Weltschau vorführt« – viel eher sei es »die Sprache selbst, die durch ihn spricht«.
Brodsky hat sich nicht gescheut, die Sprache als sein »Allerheiligstes« zu bezeichnen und von seiner Dichtung zu sagen, sie komme »von Gott«. Aber er hat gelegentlich auch – mit selbstironischem Unterton – von der »Muse, geb. Sprache« berichtet, welche ihm seine (oder eben ihre) Texte diktiert habe, und zwar als »reine sprachliche Notwendigkeit, die mit jedem Verlust zunimmt, die proportional ist zur Unfähigkeit der Toten zu sprechen«. Die Muse – die Sprache – hat immer schon gesprochen, wenn der Dichter zu sprechen beginnt, und wenn er verstummt, spricht sie weiter.
Geboren ist Joseph Brodsky am 24. Mai 1940 in Leningrad. Schon als Fünfzehnjähriger verließ er die Schule, mit achtzehn schrieb er seine ersten Gedichte, fand bald schon Freunde und Förderer in literarischen Kreisen, konnte aber – außer vereinzelten Übersetzungen – offiziell nichts publizieren. Bereits 1963 wurde Brodsky verhaftet und (weil er keiner »geregelten« Arbeit nachging und vom sowjetischen Schriftstellerverband als Autor nicht anerkannt war) des »Schmarotzertums« angeklagt. Nach einem aufsehenerregenden Prozeß verurteilte man ihn zu fünf Jahren Zwangsarbeit und verschickte ihn in den hohen Norden.
Massive Proteste namhafter russischer Autoren – darunter Anna Achmatowa und Konstantin Paustowskij – sowie scharfe Polemiken der westlichen Presse bewirkten Brodskys vorzeitige Entlassung. Im Juni 1972 wurde er aus der UdSSR ausgebürgert und nach Wien abgeschoben, von wo aus er – als Jude – ins israelische Exil weiterreisen sollte. Durch Vermittlung seines amerikanischen Verlegers Carl R. Proffer erhielt Brodsky aber einen Lehrauftrag an der University of Michigan in Ann Arbor, was ihn zur Übersiedlung in die USA bewog, wo schon 1965 – in russischer Originalfassung – eine größere Sammlung seiner Gedichte und Poeme erschienen war.
Brodsky übernahm in der Folge eine Professur an der Columbia University in New York, veröffentlichte ab 1977 mehrere neue Lyrikbücher, schrieb Essays (zuletzt die Sammlung On Grief and Reason, 1995) und Erinnerungen in englischer Sprache, übersetzte eigene Gedichte aus dem Russischen ins Englische, wurde Mitglied zahlreicher kultureller Institutionen und Träger hoher Auszeichnungen – 1987, im Alter von 47 Jahren, erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Fast gleichzeitig setzte in Rußland, unter den neuen Bedingungen von Glasnost und Perestrojka, seine Rehabilitierung ein. »Dichter kehren immer zurück«, hatte er nach seiner Ausbürgerung geschrieben, »sei es persönlich oder auf dem Papier«. Persönlich ist Joseph Brodsky nicht nach Rußland zurückgekehrt, doch »auf dem Papier« gehört er heute in seiner Heimat zu den meistpublizierten und meistgelesenen zeitgenössischen Dichtern überhaupt – seit 1992 sind drei mehrbändige Werkausgaben und diverse Auswahlbände erschienen; neue Texte wurden und werden laufend in den führenden russischen Literaturzeitschriften abgedruckt; die Sekundärliteratur zu Brodsky ist in ihrer Quantität längst unüberschaubar geworden und expandiert – in Form von Abhandlungen, Erinnerungen, Kommentaren – ständig weiter. Brodskys Ruhm geht so weit, daß ein russischer Kritiker unlängst meinte feststellen zu müssen, es gebe »außer Brodsky« auch noch ein paar andere Autoren…
Dieser Ruhm ist in der Tat staunenswert angesichts des elitären Anspruchs, der formalen und thematischen Komplexität von Brodskys lyrischem wie auch essayistischem Werk. Seine einzelgängerische, ja einzelkämpferische Rücksichtslosigkeit, die keinerlei Konzession an den Publikumsgeschmack oder die Erwartungen der professionellen Kritik zuließ, müßte – so sollte man denken – eher abschreckend als gewinnend wirken. Abschreckend könnten auch Brodskys ständige Wiederholungen, seine vielen Widersprüche, seine rechthaberischen Behauptungen, seine endzeitlichen Zynismen, seine provozierenden Bescheidenheitsformeln sein – abgesehen davon, daß kaum noch jemand bei klassischen Vers- und Strophenformen, bei mythologischen Allusionen und generell bei erhabenen Dingen wie Liebe und Tod und Schönheit und Gott sich aufhalten mag.
Wenn Brodsky gleichwohl ein großes Publikum für sich gewonnen hat, so gewiß deshalb, weil er gerade nicht das große Publikum, sondern stets den einzelnen Leser anspricht; weil jeder einzelne Leser von ihm ernst genommen, gleichsam in ein Privatgespräch einbezogen und mit immer wieder neuen Fragen konfrontiert wird, die nur der Autor so hat stellen können und deren Beantwortung allein vom Leser abzuhängen scheint:
Fragst Du: Wohin?, bleibt die Antwort
aus. Denn in ewigem Eis
ist die Welt fest verankert.
Auch das Riesenreich
der Sprache hat seinen Norden,
den Pol, wo Schnee und Wind
durch alte Drucke torkeln;
wo das Wort nichts mehr gilt.
Joseph Brodsky ist tot; die Sprache – die Muse – lebt: sie spricht weiter durch sein Werk, und sein Werk spricht, sofern der Leser ihm dazu verhilft, für sie.
Felix Philipp Ingold, Schreibheft, Heft 47, Mai 1996
Lebenslauf
Nachrufe
Gedenktag
Zum 25. Todestag des Autors:
Zakhar Ishov: Brodskys Venedig
dekoder.org, 28.1.2021











