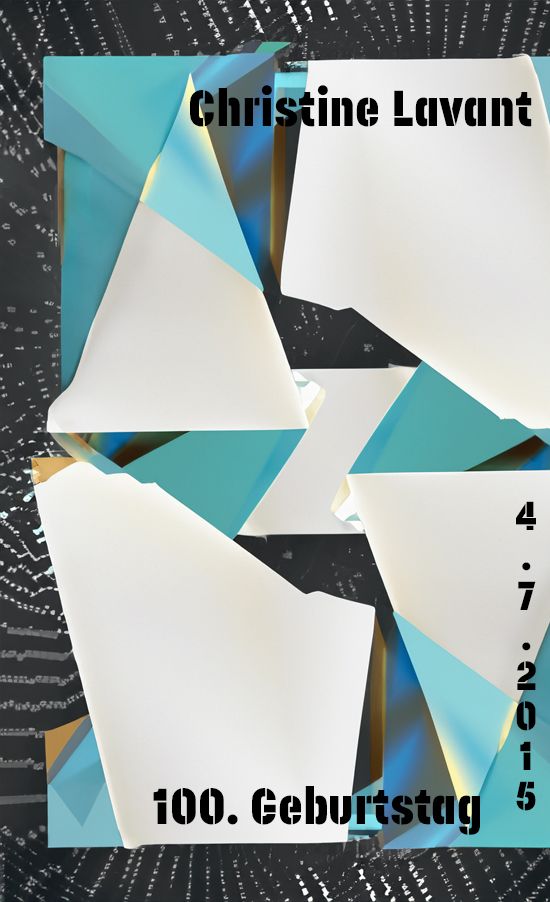
Thomas Bernhard fand sie gescheit und durchtrieben
– Christine Lavant kam aus Kärnten und trug immer Kopftuch. Soweit die Legende von katholischen Schmerzensfrau. Zum 100. Geburtstag ist die große Dichterin ganz neu wiederzuentdecken. Klischeefrei. –
An der Hand des großen Menschen läuft der kleine Mensch in die Welt. Der große Mensch achtet aufs Nötige und Gewohnte, manchmal aber tritt das Gewohnte plötzlich zurück und vor dem freien Blick steht der kleine Mensch in seinem seltsamen Anderssein, das auch einmal das des großen war.
Wer gerade ohne Kind ist, kann diese Erfahrung mit einer Erzählung machen, die Das Kind heißt, knappe 41 Seiten umfasst und so beginnt:
Da ist ein langer Gang. Und er hat weißgestrichene Türen rechts und links – viele weißgestrichene Türen. Oben, ganz hoch oben, wo vielleicht schon der Rand vom Himmel anfängt und wo man auch mit ganz weit aufgerissenen Augen nicht hinaufsieht, ist etwas Schwarzes. Was dieses Schwarze ist, wird man vielleicht einmal wissen, wenn man tot ist, weil dann weiß man alles.
Ein lakonischer, gewaltiger Anfang. Er zeigt, was das Erzählen kann: eine Situation vergegenwärtigen, ohne sie zu erklären, etwas mitteilen, ohne es zu benennen (Krankenhaus), ein Schauen wiedergeben, das etwas über den Schauenden verrät (klein, kindlich, kurzsichtig) und dennoch geheimnisvoll bleibt. Denn das Subjekt heißt weder »ich« noch »sie« (dass es um ein Mädchen geht, hat bereits das ausdrucksvolle Cover angedeutet), sondern »man«, ein vom Mädchen selbst so empfundener sprachlicher Unterschlupf, in den auch der Leser sofort hineinrutscht.
Das Mädchen wurde aus seinem Heimatdorf in ein Hospital gebracht, es leidet an Skrofulose, also Wunden am ganzen Körper, und ist überall verbunden. Die Mutter hat kein Geld für den Zug, um das Kind zu besuchen, die Krankenschwestern kümmern sich wenig. Auf der Station gibt es noch andere kleine Patienten, zwischen ihnen geht es um Macht und das Mädchen fügt sich, einmal wagt es bebend den Aufstand.
Die wichtigste Person bleibt aber der verehrte, gütige Chefarzt, der Primarius, wie er in Österreich genannt wird. Ausgerechnet der behauptet dann etwas, das nicht stimmt und das Mädchen ganz aus der Fassung bringt! Was soll es denken, wie steht es um die Klugheit der Erwachsenen und die Gerechtigkeit Gottes? Welches Opfer kann das Kind Gott anbieten, damit die Welt wieder in Ordnung kommt und der Primarius trotz Lüge in den Himmel?
Das Kind betet, aber Gott macht wohl gerade einen Ausflug oder kann keinen Engel entbehren; die Hilfe bleibt aus. Dennoch behält das Mädchen seinen aufmüpfigen Humor: Es schlussfolgert, dass auch Gott überfordert ist, leider oft.
Eine ziemlich abstruse Geschichte, wie es scheint, und etwas altbacken. Aber das ist sie keineswegs. Ihr Faszinosum ist der »oszillierender Ton«, wie der Herausgeber Klaus Amann in seinem klugen Nachwort feststellt. Immerfort wechselt die Erzählerin zwischen der Nahsicht des naiven Kindes und der eigenen, sanft ironisierenden Allwissenheit. Katholische Bizarrerien reihen sich aneinander, die man beängstigend finden kann oder lächerlich, aber vom Wettern gegen die Kirche wie bei Thomas Bernhard oder vom Kindheitsalbtraum wie bei Franz Innerhofer sind wir hier weit entfernt.
Empörung und Anklage fehlen ebenso wie Erbaulichkeit, Sentimentalität und Schönreden. Das Leben ist ja selten so eindeutig, wie die großen Zeterer der Literatur es darstellen, es schillert immer ins Gegenteilige hinein. So konzentriert die Autorin ihre Kunst auf die, wie sie in einem Brief formulierte, »inständige Wirklichkeit« des Kindseins.
Ja, inständig, das trifft es genau und macht die Erzählung zu einem Ereignis, heute noch und auch für Leser, die mit ländlich-religiösem Hokuspokus nichts im Sinn haben. Sprachlich souverän, zart komisch und anrührend, nirgendwo abstürzend, gegen Ende ein wenig pathetisch, aber insgesamt federleicht, findet die Geschichte mühelos einen Platz zwischen Thomas Bernhards »Ein Kind« und Handkes »Kindergeschichte« und überstrahlt in ihrer Schlichtheit sogar das erstmals 2012 publizierte, bereits der fünften Auflage entgegensteuernde Wechselbälgchen.
Höchste Zeit jetzt, von der Autorin zu sprechen. Als Christine Thonhauser wurde sie am 4. Juli 1915 geboren, neuntes Kind einer bitterarmen Bergmannsfamilie, schon als Säugling mit Krankheiten geschlagen, später halb blind, halb taub, tuberkulös. Mit den neu entdeckten Röntgenstrahlen wurde die Tuberkulose »verbrannt«, einerseits lebensrettend, andererseits schmerzhaft nachwirkend. Auch das Kopftuch, das sie ständig trug und das nachgerade ikonisch wurde, diente dazu, die Wunden bzw. die Folgen der Wundbehandlung zu verbergen.
Nach dem Tod der Eltern heiratete sie »aus Mitleid« einen 36 Jahre älteren, mittellosen Maler, den sie wie sich selbst mit dem Lohn für Strickarbeiten ernährte. Als sie dem Maler Werner Berg begegnete, mit dem sie hätte leben wollen, erfuhr sie die Erschütterungen einer aussichtslosen Liebe. So viel Drangsal, kurzum, dass Suizidversuche und Aufenthalte in der Psychiatrie sich von selbst verstehen und die Unglückshäufung eher Abwehr als Mitleid provoziert.
Der andere Teil ihrer Geschichte liest sich so: Sie nahm ein Pseudonym an (den schönen Namen des Flusses, der durch ihr Heimattal fließt), besuchte zwar nur ein paar Grundschulklassen und verwechselte »mir« und »mich«, schrieb jedoch über 1.000 formbewusste Gedichte, an die 2.000 Briefe und mehr als ein Dutzend Erzählungen. Sie korrespondierte mit Nelly Sachs, Martin Buber, Hilde Domin, Thomas Bernhard und Wieland Schmied, fuhr zu Lesungen und war Gast auf dem berühmten Tonhof des Ehepaars Lampersberg, dem österreichischen Kult- und Kulturort der Fünfzigerjahre.
Aus den Kärntner Bergen reiste sie 1958 auf Einladung der St.-Georgs-Bruderschaft ganz allein und erster Klasse mit dem Orientexpress nach Istanbul, wo sie drei glückliche Wochen verbrachte. Und schließlich und immerhin erhielt sie den Österreichischen Staatspreis für Literatur, zweimal den Georg-Trakl-Preis für Lyrik, fand Anerkennung, finanzielle Unterstützung und immer noch wachsenden Ruhm.
Wie stellt man sich eine solche Person vor? Elend, verzweifelt, klagend? Oder begabt mit unerschrockenem Charme, zäh und durchsetzungsfähig? Alles auf einmal offenbar.
Thomas Bernhard, nicht gerade bekannt für kollegiale Zuneigung, schätzte ihre Gedichte und gab 1987, vierzehn Jahre nach Lavants Tod, eine Auswahl in der Bibliothek Suhrkamp heraus. In einem Brief charakterisierte er sie so:
Die Lavant war eine völlig ungeistige, sehr gescheite, durchtriebene. Sie wohnte auf der Betondecke eines Supermarktes an einer Straßenkreuzung in Wolfsberg und tippte ihre Gedichte gleich in die Maschine. Das ist für mich großartiger als das verlogene Weltfremdmärchen mit katholischer Talschlussromantik, das gottbefohlene, das um sie bis heute immer verbreitet worden ist.
Kein Mangel also an Widersprüchen, im Leben wie im Nachleben. Einhellig gerühmt wurde ihre Lyrik, während die Erzählungen eher als Nebenherarbeiten galten, oft auch jahrelang vergriffen waren. Hinter Lavant stand kein mächtiger Verlag, die Editionsgeschichte ihrer Werke ist so kompliziert wie trostlos und bis heute von Streit und Scheitern begleitet. Viele Texte gingen verloren, viele opferte sie dem Einheizen.
Dass es derart lange gedauert hat bis zur ersten Gesamtausgabe, die jetzt bei Wallstein in Göttingen mit finanzieller Unterstützung des Wiener Unternehmers Hans Schmid realisiert wird, ist auf traurige Weise skandalös. Zum Glück hat aber das Herausgeberteam seine Chance vorzüglich genutzt. Die Textgestaltung wird plausibel begründet, die Nachworte erhellen Kontexte und Bezüge und die Anmerkungen erklären die wunderbaren Austriazismen wie »sekkieren«, »Kinigelhase« oder »Gesatzel«.
Vier Bände sind geplant, im letzten Herbst erschien der erste, der auf 600 Textseiten sämtliche zu Lavants Lebzeiten veröffentlichte Gedichte enthält, zu dem sich 2016 im dritten Band noch die bislang unveröffentlichten gesellen werden. Selbst für sehr hungrige Lyrikliebhaber dürfte das eine übervolle Schüssel sein, deren Genuss lange Pausen erfordert.
Da sich der Ton trotz wechselnder Formen kaum ändert und die Metaphorik aus einem begrenzten Fundus schöpft, gestaltet sich die Lektüre so stetig wie betäubend. Um und um verbreitet da der Mond sein Licht, die Kräutlein warten und die Liebe ist eine einzige Verzweiflung. Damit soll Lavants Virtuosität, was Reim, Metrik, Kombinationsgabe und schöne Dunkelheiten betrifft, nicht geleugnet werden.
Doch wirken diese Gedichte heute wie aus der Zeit gefallen, sie tragen einem mit »Du« angeredeten Gott ihre Klagen in einer gleichsam »ewigen« Sprache vor. Jene singulären Gebilde auszumachen, die konkret genug sind, einem geradewegs ins Herz fahren, erfordert Geduld.
Als wirksame Hilfestellung, auch zur Einführung bestens geeignet, erweist sich die Anthologie Drehe die Herzspindel weiter für mich, eine Hommage an »Christine Lavant zum 100.«, in der zehn Lavant-Gedichte samt kommentierenden oder poetischen Reaktionen von 27 zeitgenössischen Autoren und Autorinnen versammelt sind.
Schon nach wenigen Seiten begegnen wir dem bezaubernden »Das ist die Wiese Zittergras«, später »Ich verlege die Ortschaft von rechts nach links«, wieder eine Perle, und dann erzählt Michael Krüger, wie er als protestantisch beseelter Jüngling vor Lavants Katholizismus erschrak, Ann Cotten schießt mit Hegel und Kojève, Ilma Rakusa skizziert auf sieben trefflichen Seiten Person und Werk und sehr gewitzt und suggestiv schildert Kathrin Schmidt das eigene Coming-of-Age entlang von Wörtern in Großbuchstaben, die, hintereinander gelesen, ein Lavant-Gedicht ergeben.
Man kann nur wünschen, dass, siehe oben, die Toten alles wissen und die Thonhauser Christl irgendwo sitzt und liest und sich freut, mit wie viel Geist und Empathie sie gewürdigt wird.
Im November wird der zweite Band der Werkausgabe erscheinen, der die zu Lebzeiten gedruckten, aber verstreuten und kaum noch zugänglichen Erzählungen enthält. Eröffnet wird er mit Lavants Debüt von 1948, eben jener schon als Einzelauskopplung präsentierten Geschichte »Das Kind«, deren erste Sätze von Türen handeln, die keine »richtigen Türen« sind, sondern Pforten zur Ewigkeit.
Ein sprechender Zufall will es, dass auch der letzte Text von Türen erzählt. Er heißt »Die Türgeschichte« und umfasst nur drei Seiten, die 1956 in einer Zeitschrift als Vorabdruck aus einem Manuskript erschienen, das mal wieder verloren ging (könnten zum hundertsten Geburtstag nicht mal sämtliche österreichische Dachböden nach Lavant-Texten durchsucht werden?). Diesmal handelt es sich um eine »richtige« Tür, nämlich die, die in den Ein-Zimmer-Mikrokosmos der Familie Thonhauser führt.
Das Kind hat mit der rosaroten Stoffkreide auf die braunfleckige Stubentür eine Geschichte geschrieben. Es ist eine sehr lange Geschichte von einem Vater, der mit einem roten Holzkoffer heimkommt, darin hausen sein Rasiermesser, seine Sonntagsschuhe und eine Sprechpuppe zusammen.
Leider kann niemand die Geschichte entziffern, nur Flecken sind auf dem Holz zu sehen und der größte Fleck entpuppt sich als »der faule Engel«, der sogleich mit dem Vater zu reden beginnt. Und so geht es weiter in zauberhafter Melange, Kindliches und Fantastisches und allertrübste Wirklichkeit untereinander mischend. »Zitternd« springt die Tür auf in einen Textraum, der weit über die Klatsch- und Kummergeschichten hinausreicht, die sich die Dorffrauen bei der Mutter des Kindes von der Seele reden.
Sicher werden die gesammelten Erzählungen den Blick auf die Autorin nachhaltig verändern. Das Kultbild der bei Kerzenlicht mit Gott hadernden, Leiden und Tod beseufzenden Dichterin im Umschlagtuch wird der Bewunderung für eine hochempfindsame, raffinierte Darstellerin sehr realer Verhältnisse weichen. Die Verhältnisse haben sich geändert, glücklicherweise, und lesend wird man vielleicht ein wenig fremdeln in diesem abgeschotteten Lavanttal. Aber hier wie überall kommt es eben auf die Erzählkunst an, damit Geschichten wie »Wunderbrötlein« funktionieren.
Wenn die Werkausgabe komplett (der vierte Band wird Prosa aus dem Nachlass enthalten, darunter Das Wechselbälgchen) und die juristische Auseinandersetzung um die Rechte beendet ist, kann hoffentlich auch der eine oder andere Briefwechsel erscheinen.
Danach wird es dann Zeit, das nächste Gedenkjahr vorzubereiten: 2023 jährt sich Lavants Todestag zum 50. Mal, und nicht allein ihrer, sondern auch der von Ingeborg Bachmann. Nur um ein paar Monate hat die Jüngere die Ältere überlebt. Beide stammten aus Kärnten, beide haben einander weder gekannt noch wahrgenommen, beide wurden zu mythischen Figuren, Bachmann sehr öffentlich, Lavant insgeheim, als Flüsterbotschaft. Die eine im Licht der anderen zu imaginieren, sozusagen Bachmann mit Kopftuch und Lavant als Ikone der Suhrkamp-Kultur, ist ein vertracktes Vergnügen.
Gisela Trahms, Die Welt, 4.7.2015
Lebenslauf
Fakten und Vermutungen zur Autorin im Museum + Homepage +
Archiv + Internet Archive + Kalliope + KLG + IMDb + Gesellschaft
Porträtgalerie
Lesung
Nachruf
Gedenktage
Zum 100. Geburtstag der Autorin:
Franz Haas: Beten und das Kreuz zertreten
Neue Zürcher Zeitung, 4.7.2015
Carola Leitner: „Das verstümmelte Leben“
orf.at, 4.7.2015
Gisela Trahms: Thomas Bernhard fand sie gescheit und durchtrieben
Die Welt, 4.7.2015
Andreas Kohm: „Aber das Schreiben ist das Einzige, was ich habe“
Badische Zeitung, 3.7.2015
Gabriele Kögl: Christine Lavant: Der Sonnenapfel ist ein Lavanttaler
der Standart, 4.7.2015
Hubert Gaisbauer: Christine Lavant: „Gott, sag das nicht“
Die Furche, 2.7.2015
Arnold Mettnitzer: Zu Christine Lavant
ORF.at
Zum 50. Todestag der Autorin:
Victor Strauch: Schriftstellerin aus armen Verhältnissen schuf bedeutende Literatur
Neue Zeit, 6.6.2023
Michael Swersina im Gespräch mit Franz Bachhiesl über Christine Lavant: „Ich traf sie regelmäßig auf meinem Schulweg in St. Stefan“
Unterkärntner Nachrichten, 7.6.2023











